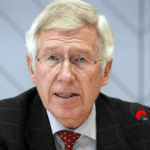Zurück zur Friedenspolitik, zurück zur Neutralität!
Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine übernahm die Schweiz nach massivem Druck der USA und der EU die Sanktionen gegen Russland. Damit war die Neutralität schwer beschädigt. Als der Bundesrat seine Solidarität mit Selenskyj und der Ukraine erklärte, schlug sich die Schweiz auf die Seite einer Konfliktpartei. Die Neutralität war so vorerst beerdigt. Prompt reagierte das russische Aussenministerium und erklärte in der Sprache der Diplomatie die Schweiz zu einem «unfreundlichen Staat». – Entscheidend ist immer, wie die Aussenwelt einen Staat wahrnimmt. Der Neutrale muss daher neutral bleiben, auch wenn sich «Teufel» und «Engel» bekriegen. Nur so kann er seine Glaubwürdigkeit bewahren.
Der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz, sprach drei Tage nach Beginn des Krieges von einer «Zeitenwende» und machte massiv mobil gegen Russland. Der Westen war sich einig, dass die Ukraine die Krim zurückerobern und Russland eine krachende Niederlage zufügen würde. Nato und EU schienen zusammen mit den USA ein unverrückbarer Machtblock, der die Welt für die nächsten Jahrzehnte bestimmte. Russland werde kein Machtfaktor mehr in Europa sein, wenn alle zusammenstehen. Daher bestehe auch keine Gefahr, dass die neue Ordnung zerstört werde.
Unterstützt wurde das Ganze von einer medialen Walze, die die Kriegsstimmung kontinuierlich befeuerte. Wer aus der Reihe tanzte und wagte, eine andere Meinung zu vertreten, wurde mit medialem Sperrfeuer wieder auf Linie gebracht, um es martialisch auszudrücken.
Geblendet von der westlichen Politik und aus geopolitscher Kurzsichtigkeit näherte sich die Schweiz in unglaublicher Geschwindigkeit der Nato und der EU an. Die Möglichkeit, dass Putin ganz Europa erobere und am Schluss an der Grenze zur Schweiz stehe, wurde zum Schreckensszenario, das klares Denken verhinderte.
Je länger Krieg andauerte, um so mehr Risse bekam die neue westlich dominierte Weltordnung. Einzelne Mitglieder der EU oder der Nato hegten Zweifel an der Richtigkeit dieser Politik, aber auch Länder des globalen Südens oder Asiens schlossen sich trotz massiver Einflussnahme nicht den Sanktionen gegen Russland an und lieferten auch keine Waffen an die Ukraine. Annalena Baerbock weibelte von einem Land zum anderen, um es für die Anti-Putin-Koalition zu gewinnen, aber sie erntete nur Absagen. Die Nato hielt daran fest, dass der Westen die Regeln bestimme, und ist weiterhin auf Kriegskurs.
Dann der grosse «Schock». Donald Trump wird neuer US-Präsident und fängt sogleich an, sein Versprechen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, umzusetzen. Er beginnt mit Verhandlungen, aber nicht in der ehemals neutralen Schweiz, sondern in Saudi-Arabien. Die grossen EU- und Nato-Länder setzen indes weiterhin auf Krieg.
Was soll die Schweiz nun tun? Sich weiterhin den Kriegsgurgeln in Europa oder den Bemühungen Donald Trumps anschliessen, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden? Nach der bisherigen Haltung ein schier unlösbares Dilemma. Die offizielle Schweiz, von der Unumstösslichkeit der westlichen Dominanz überzeugt, wird seit einigen Wochen eines Besseren belehrt.
Hätte der Schweizer Bundesrat nicht achtlos die Neutralität aufgegeben, wäre die Schweiz wahrscheinlich heute der Ort, an dem die diplomatischen Gespräche stattfänden, und nicht Saudi-Arabien.
Der Neutrale macht sich selten Freunde, weil er sich auf keine Seite schlägt. Das ist manchmal schwer zu ertragen und braucht von den politisch Verantwortlichen innere Standfestigkeit, denn – wie wir feststellen können – kommt die massive Kritik nicht nur von aussen, sondern auch von innen. Unsere grossen Medien bleiben stupide auf Kriegskurs und attackieren jeden, der sich für Verhandlungen einsetzt, ob es die Bundespräsidentin Karin Keller-Suter ist oder Bundesrat Ignazio Cassis.
Der neutrale Staat entfaltet nach aussen seine Wirkung, wenn er als Mediator gefragt ist, um zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln. Dann sind beide Seiten dankbar, dass sie sich auf die Neutralität des Vermittlers verlassen können. Zu diesem Ansehen muss die Schweiz dringend zurückfinden. Jetzt wäre die Gelegenheit, um wieder eine Stimme des Friedens zu werden.
(Red.) Dieser Beitrag erschien zuerst am 26. Februar 2025 auf der Plattform und im gedruckten Magazin «Zeitgeschehen im Fokus», in deren Redaktion Thomas Kaiser aktiv ist.