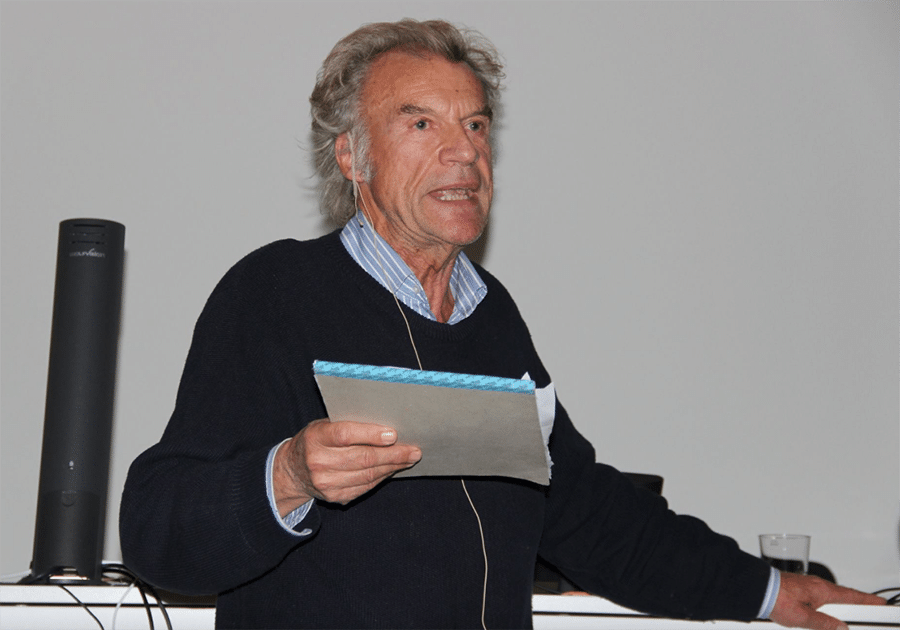
Analyse | Der Zollstreit und die Neutralität
(Red.) Für die Schweiz war die historisch gewachsene Neutralität immer eine gute Lösung. Die Situation war nicht nur für die Schweiz gut, die Schweiz war als international anerkanntes neutrales Land zusätzlich in der Lage, bei Konflikten zwischen anderen Ländern willkommene Vermittlungsdienste zu leisten. Und es gibt auch wirtschaftliche Gründe, warum die Schweiz als neutrales Land besser fährt, als wenn es sich der EU, der NATO oder den USA annähert. Hans Bieri, Dipl. Arch. ETH/SIA und belesener Geschäftsführer und Vorsitzender der «Schweizerischen Vereinigung Industrie und Landwirtschaft» (SVIL) erklärt im folgenden, warum die Schweiz unbedingt an der Neutralität festhalten muss. Seine Erklärungen zur Wirtschaftsgeschichte sind für Nicht-Historiker nicht immer einfach zu verstehen, die Redaktion hat sich deshalb erlaubt, einige seiner Abschnitte durch fette Schrift auszuzeichnen. Wer nicht alles Lesen kann oder will, soll zumindest diese Passagen genau lesen. Es lohnt sich! (cm)
Bei der in den USA ausgelösten Finanzkrise von 2008 und der anschliessenden Plünderung der deutschen Mittelstandsvermögen durch die amerikanischen ‘Heuschrecken’ stellte damals der Chefredaktor Frank Schirrmacher in der FAZ die Frage, hatte Karl Marx doch recht? Heute nach dem Zollhammer aus den USA verkündet Eric Gujer von der NZZ (9. August 2025, S. 1) das «Ende der liberalen Ordnung» und ihren Wandel zum «Raubtierkapitalismus». Fragt sich nun auch Eric Gujer, hatte Lenin doch recht? Es geht um die 1916 in Zürich verfasste Schrift über den «Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus». «Diese liberale Weltordnung ist unwiderruflich zu Ende gegangen». «Die Ära der Freiheit, die mit dem Fall der Berliner Mauer so hoffnungsfroh begonnen hatte, ist kollabiert.» So urteilt Gujer, ohne ein Wort zur Konfliktentwicklung, geschweige denn einen Gedanken, wie die verlorene Freiheit wieder gewonnen werden kann. In seinem Katastrophenszenario hat Gujer für die Neutralität der «Schweiz als Schlafwandler» nur noch mitleidiges Lächeln übrig, um dann mit grosser Geste anzukündigen, «Die Schweiz benötigt eine Grand Strategy.»
«Seit je bewegen sich die Schweizer wie Schlafwandler durch die internationalen Krisen. Was geht uns das an? Diese Frage prägt die helvetische Aussenpolitik. Weil wir neutral sind, uns aus fremden Händeln heraushalten und nur unsere Geschäfte machen wollen, glauben wir, dass alle uns respektieren und schätzen.» Die Schweiz sei «Profiteurin einer Ordnung, die sie selbst nicht erschaffen hatte und die zu erhalten sie zu schwach ist.» Gujer stuft die Schweiz ein als «Schlaumeier im Krisenmodus». Deshalb will Gujer der Schweiz freie globale Wirtschaftsbeziehungen ausreden und ihr stattdessen einen festen Platz unter den «Willigen» der EU zuweisen. «Das Schnellboot bleibt ein libertärer Wunschtraum. Der Geleitzug hingegen bietet Sicherheit. Der Zollhammer zeigt, welche Risiken der Alleingang birgt. Souveränität hat ihren Preis, der sich jetzt genau beziffern lässt: 24 Prozentpunkte. Das ist die Differenz zwischen dem Zollsatz für die Schweiz und jenem für die EU.» Und falls die Schweiz nicht Teil des EU-Geschwaders werden möchte, bleibe ihr im internationalen Handel eh nur ein Platz auf fremden Galeeren international mächtiger Abnehmerländer. «Denn wer nicht lokal produziert, riskiert seinen Marktzugang. Das gilt längst nicht nur für [Exporte in] die USA, sondern ebenso für China, Indien – und zunehmend auch für die EU. Brüssel knüpft Investitionsprogramme und Ausschreibungen immer häufiger an lokale Wertschöpfung. Schweizer Firmen können zwar weiterhin am europäischen Markt teilnehmen. Doch ohne eigene Produktion in der EU wird der Zugang zu Fördermitteln und Projekten zunehmend schwierig.» (NZZ, 11. August 2025, S.17, Jürg Meier)
Muss die Schweiz Konzessionen machen?
Kurz zusammengefasst folgert die NZZ aus dem Raubtierkapitalismus, dass die Schweiz ihr wirtschaftliches Potential im Bereich der Güterproduktion nicht mehr im freien Handel auf der Basis des gegenseitigen Vorteils weiterzuentwickeln, sondern die Produktion direkt und jeweils lokal in die Hemisphären der Raubtiere zu verlegen hat. Die politische Zwerghaftigkeit der Schweiz lasse ihr nichts anderes übrig. Zur Bewältigung des raubtierkapitalistischen Zollhammers der Trump-Administration schlägt Jürg Meier ebenfalls die Verlagerung des schweizerischen Produktionsstandortes in die lokale Produktion der EU und der USA als Lösung vor. Dies bedeutet Abschied von den Wirtschaftsbeziehungen auf der Basis des gegenseitigen Vorteils — und Verlegung der Produktion in diese Abnehmerländer selbst. «Die Schweiz wird Konzessionen machen müssen, wenn sie weiterhin vom globalen Wachstum profitieren will.»
Doch wovon soll die Schweiz leben bzw. «profitieren», wenn nun auch die produzierende Industrie unter dem Druck des Zollhammers ausgelagert werden soll? Wovon lebt dann die Schweiz? Ohne Export von Gütern des Bedarfs keinen Import von Gütern des Bedarfs. Der Export von Gütern des Bedarfes ist dazu da, den Import der Güter des Bedarfs zu bezahlen. Aussenhandel ist nicht dazu da, zum Immobilienwachstum der Schweiz zur Megacity beizutragen. Ökonomen sagten jüngst, in der Schweiz verbleibe nur noch die wertschöpfungsintensive Innovation und das Marketing, während die Produktionsstätten ausgelagert werden. Produzieren würden in der Schweiz eh nur noch die zugewanderten Ausländer, während die Schweizer nur noch den umtriebigen Wachstumsprozess zur Megacity verwalten würden. Wie ein simpler Bodenspekulant lebt die Schweiz nur noch davon, ihr Land zu verbauen.
Diese Fragen werden im Hinblick auf die 10-Millionenschweiz nicht diskutiert. Es herrscht ein saturierter Wohlstandsbegriff, der die Sicht der Anleger und nicht der Verbraucher wiedergibt, obwohl der Schwund der Lebensgrundlage und die Schädigung des Kulturprozesses durch diese Bevölkerungseinwanderung und -umschichtung über ganze Kontinente hinweg auch jeder Nachhaltigkeit spottet. Dient die Einwanderung letztendlich einer Kapitalanlage- und -verwertungsspirale? Sind die Naturgrundlage und die produktive Basis für den Güterbedarf überhaupt für eine solche Immobilienentwicklung noch vorhanden?
Zur politischen und wirtschaftlichen Substanz der Schweiz
Ist es nicht symptomatisch, dass der Immobilienspekulant Donald Trump in seinem Alter eine politische Diskussion aufgreift, wovon die USA — gemeint ist nicht das global sich gegenseitig herumschiebende Kapital — denn eigentlich leben? Kann man die Produktion nach China verlagern und daraus über die Zeit gesicherte Monopolprofite ziehen? Doch, wie die USA unter Trump nun realisieren, man kann Innovation und Fertigung letztlich auf lange Frist nicht trennen. Und genau darum geht es bei der von Trump lancierten Frage um die negative Handelsbilanz im Bereich der Güterproduktion. Es geht nicht eigentlich um Zölle, sondern um das Handelsungleichgewicht und die Verschuldung der USA. Da hilft auch der Einspruch mit Ricardos komparativem Kostenvorteil nicht weiter. Denn die weitere Verlagerung der Produktionsstätten der KMU in die Absatzländer zerstört den Industriestandort Schweiz. Die über 100-jährige politisch-ökonomische Konfliktentwicklung mit den grossen Wirtschaftskrisen treibt die arbeitsteilige Wirtschaftsentwicklung notwendigerweise zur Erschliessung von Aussenmärkten und zum Kolonialismus.
In jedem Land sollte es jedoch primär um die Entwicklung des inneren Marktes gehen. Produktionsmittel- als auch Konsumgüterindustrie werden erweitert zusammen mit Produktion und Konsum, die gesamthaft gegenseitig in sich aufgehen müssen. Diese Erweiterung des Marktes im eigenen Land dient allein dazu, die Bedürfnisse zu decken.
Erst wenn Produktion und Konsum nicht mehr ineinander aufgehen und zu Wirtschaftskrisen führen, entsteht der merkantilistische Zwang zur Eroberung fremder Ressourcen und fremder Märkte, zum Imperialismus und zu den bisher bekannten Kriegen. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Anstatt sich zu interessieren, warum die Schweiz ohne Rohstoffe sich industriell im weltweiten Handelsaustausch wirtschaftlich konfliktfrei entwickeln konnte, wirft Gujer der Schweiz ihre politischen Niederlagen bei den nachrichtenlosen Vermögen, dem Bankgeheimnis, also genau in jenen Bereichen vor, die ja zum Vorneherein mit der KMU-Wirtschaft nichts zu tun haben und durch Monopolstellungen auf eine andere Art Geld verdienen. Gujer kritisiert auch den Vergleich zur «sister republic» der USA als geplatzte Selbsttäuschung. Die Schweiz sei ein politischer Zwerg.
Diese Implosion der Substanz der politischen Schweiz in Gujers Kopf bedarf einer Klärung.
Der Freisinn hatte stets die Übergriffe Napoleons auf die Eidgenossenschaft sowie den Sonderbundskrieg nicht über die geschichtliche Perspektive der eidgenössischen Urschweiz, sondern allein über die von aussen zugetragenen Gedanken der europäischen Aufklärung zu verstehen versucht, ohne die politische Praxis eines entwickelten Gemeinsinnes in der Eidgenossenschaft gleichermassen als politische Errungenschaft zu erkennen, die für die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz eine Hauptvoraussetzung war. Die Überwindung des Feudalismus und das Abschneiden alter Zöpfe mit der Aufhebung der «Untertanen»-Kantone wurde als Errungenschaft der Französischen Revolution auf die Schweiz angewandt, ohne zu berücksichtigen, dass in der Eidgenossenschaft die Konfrontation mit dem Code Napoléon vor dem Hintergrund des Genossenschaftsprinzips erfolgte und nicht wie in den anderen europäischen Ländern als Konflikt zwischen aufstrebendem Bürgertum und bislang herrschendem Feudaladel.
Eine karge Bodenrente im Gebiet der alten Eidgenossenschaft, die geringe natürliche Fruchtbarkeit und geographische Kammerung und Gliederung setzten wirtschaftliche und räumlichen Grenzen. Für die effiziente Nutzung der kargen Verhältnisse war die genossenschaftliche Form der Gemeindeökonomie zwingend und prägend. Diese Organisationsform ermöglichte ein Auskommen auch auf beschränkter natürlicher Grundrente. Zusätzliche Abgaben an eine feudale Territorialstruktur gab der Boden jedoch nicht her. Hier liegt der Grund der Kriege gegen feudale Territorialisierungsversuche. Umgekehrt blieben damit auch jene flachen dorfwirtschaftlichen und selbstversorgenden Strukturen erhalten, die verbunden mit dem kontinental, entlang der Handelswege sich entwickelnden Rohstoffhandel auf autarker Bodengrundlage früh eine erstaunliche Industrialisierung in Gebieten mit kleinräumlich, dezentral, dicht vernetzten Dorfstrukturen hervorbrachte. Man kann sagen, die Eidgenossenschaft organisierte die genossenschaftlichen Dorfstrukturen mit direkter Bindung der Menschen zum Boden als Quelle der auf diesem einzigen Vorzug sich entwickelnden gewerblichen Werktätigkeit. Die Eidgenossenschaft zeigt, wie die Organisation der Gesellschaft auf karger Naturgrundlage dennoch zu Wohlstand führt. Diese frühen eidgenössischen Errungenschaften gilt es heute zu schätzen und weiterzuentwickeln.
Die rechtliche Voraussetzung der Bildung einer von der Genossenschaft abweichenden personenähnlichen Körperschaft war die Einhegung in England und in etwas milderer Form der Code Napoléon auf dem Kontinent. Durch die eigentumsmässige Parzellierung wird die ursprünglich der Gemeinschaft zukommende Lebengrundlage dieser entzogen und der individuellen Entscheidungsgewalt von Einzelpersonen bzw. als wie Einzelpersonen handelnden Societés anonymes unterstellt.
So betrachtet ist der Code Napoléon ein Schlag gegen das Genossenschaftsprinzip. Aus der Klärung dieser Frage ergibt sich Identität, Position und Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft heute in Europa und in der Welt.
Denn gerade heute hat die Diskussion um den Beitritt der Schweiz zur EU oder das vieldiskutierte institutionelle Rahmenabkommen mit der EU und besonders die massiven Vorstösse zur Aufhebung der schweizerischen Neutralität die Fragen aufgeworfen nach der Entstehung und der Entwicklung der Schweiz in der Vergangenheit und der Zukunft.
Es geht um die grundlegende Frage wie Gemeinschaft oder Eigennutz. Dass man heute der Schweiz ihre historisch gewachsenen Strukturen ausreden will, ist nichts anderes als Ziel dieser Konfrontation selbst, die der fraktionelle Eigennutz gegen den genossenschaftlichen Gemeinsinn führt.
Die immer wiederkehrende Diskussion um die Staatsgründung der Schweiz zeigt die Unvereinbarkeit der Genossenschaft mit dem Code Napoléon, der eine fundamentale Änderung des Verhältnisses der Menschen zu ihrer Lebensgrundlage ausgelöst hat.
Die ‘Lösung’ bestand nun eben darin, dass die Sonderbundskantone den Code Napoléon in seinen eigentumsrechtlichen Konsequenzen hinnehmen mussten.
In diesem Sinne fand ein Epochenwandel statt, der in der Schweiz nicht eigentlich den Wandel vom Feudalabsolutismus zum Bürgertum beinhaltete, sondern eben den viel grundsätzlicheren Wandel, nämlich aus der bisher genossenschaftlich geteilten Lebensgrundlage einen Markt zu machen.
Dies war jedoch für die Eidgenossenschaft deshalb dennoch keine Niederlage bzw. Auflösung, weil die Eidgenossenschaft aufgrund ihrer frühzeitigen Befreiung vom Feudalgrundadel die Chance hatte, sich in der genossenschaftlich angelegten räumlichen und gesellschaftlichen Struktur frei zu entwickeln.
Darin liegt der Grund, warum der Sonderbundskrieg sofort abgebrochen wurde und man sich an der Badener Tagsatzung 1848 einigen konnte: Räumlich und gesellschaftlich war die Eidgenossenschaft so stark ausgebildet, dass der Code Napoléon sie aufgrund der Feinmaschigkeit der Dorf- und Stadtstrukturen, eben gerade aufgrund dieser flachen Strukturen nicht auflösen konnte. Wie politisch stabil und geistig-politisch nicht einnehmbar diese Struktur der kleinen Eidgenossenschaft war, belegt auch die Episode von St. Cloud 1802, als es der Delegation der Eidgenössischen Tagsatzung gelang, Napoleon von der eidgenössischen politischen Praxis zu überzeugen, sodass Napoleon sein abstraktes Reformmodell, welches er der Schweiz überstülpen wollte, aus eigener Einsicht selbst zurückzog.
Dem eidgenössischen Geist war die Problematik des Liberalismus bei dieser ‘Einigung’ von 1848 von Anfang an bewusst. Deshalb bleibt der eidgenössische Geist trotz der liberalen Reformen in wachem Bewusstsein bestehen. Guillaume Henri Dufour auch als Schüler von Simone de Sismondi waren die „nouveaux principes de l‘économie politique“ wohlbekannt, worin ganz im Gegensatz zum Merkantilismus der stete am Gemeinnutzen orientierte Ausgleich liegt. Es ist das Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum. Darin liegt der Schlüssel zur Wohlstandsentwicklung und zur Erweiterung des inneren Marktes ganz ohne koloniale Eroberungskriege. Das heisst auch, den globalen Handel nach dem Prinzip des gegenseitigen Vorteils zu entwickeln.
Ebenso entscheidend für die staatliche Eigenständigkeit der Schweiz ist die innere gesellschaftliche Stabilität.
Die soziale Frage des Eigentums, welche sich durch die Spannung zwischen dem Code Napoléon und der Neuordnung des Eigentums in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft als Klassenfrage ergeben hat, ist in der Schweiz wegen ihren dezentralen, flachen und direktdemokratischen Strukturen wesentlich entschärft worden. Weder kam es zu drückenden Abgaben noch bildeten sich grosse Machtzentren im eigenen Land.
Diese kurzen Hinweise sollen zeigen, dass die neoliberale Kritik Gujers falsch ist. Die Schweiz war nie ein substanzloser Trittbrettfahrer der Geschichte. Ganz im Gegenteil ist die Neutralität der Schweiz eine bewusst entwickelte politisch-ökonomische, zusammen mit dem Roten Kreuz weltweit beachtete Errungenschaft.
Die Konfliktlage aus Sicht der USA
Dass die USA als mächtiger Abnehmer der weltweiten Güterproduktion die Zollhürde aktuell dazu benutzen, die Rückverlagerung von Fertigungsbetrieben in die USA zu erzwingen, ist das eine. Belehrungen, dass dies wegen der entstandenen Industriewüste (rost belt) nicht einfach sei und durch erhöhte Preise den amerikanischen Konsumenten schade, mögen teilweise zutreffen. Doch geht es bei dieser «Zollübung» nicht darum, mit Industriezöllen eine schon bestehende einheimische Produktion zu schützen: Es geht um die Lösung des internationalen Grundproblems des in der Zahlungsbilanz zum Ausdruck kommenden ungleichen wirtschaftlichen Austausches. Es ist genau der globale Konflikt, den die BRICS-Staaten durch Wirtschaftsbeziehungen auf der Basis des gegenseitigen Vorteils lösen wollen. Doch die aktuellen Regierungen der westeuropäischen Länder zeigen nicht das geringste Interesse, diese von Trump aus der Zwangslage der sinkenden Weltmacht aufgeworfenen Konfliktfragen aufzunehmen und zusammen mit den USA nach Lösungen zur Stabilisierung des Welthandels und der Weltwirtschaft zu suchen und den Kolonialismus durch ein Zurück zur im Kolonialismus preisgegebenen europäischen Aufklärung endlich zum globalen Nutzen zu überwinden. Stattdessen zeigt sich umso tragischer die Unfähigkeit auch in der personellen Ausstattung der alten europäischen Kolonialländer, ihr koloniales Denken abzulegen und die Gunst der Stunde für eine stabilere Wirtschaftsordnung zu nutzen sowohl gegenüber den USA, aber viel wichtiger auch gegenüber den BRICS-Staaten. Denn es sind diese westeuropäischen Länder, die diese nicht gelöste ökonomische Frage einer ausgeglichenen wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Produktion und Konsum durch Expansion nach aussen fremden Ländern mit militärischer Gewalt aufgezwungen und damit ihre eigene Wirtschaft auf Kosten der anderen Länder und Kontinente globalisiert haben.
Der Zollhammer zum 1. August
Die von der schweizerischen KMU-Wirtschaft zu Recht festgestellte Fassungslosigkeit über den Zollhammer von 39% am 1. August 2025 ist nicht das verdiente Ungemach eines Trittbrettfahrers, wie sich Gujer im ausgebrochenen Raubtierkapitalismus einen Reim zu machen versucht. Vielmehr ist der Katzenjammer die Folge davon, dass man — nebst den grossen Anstrengungen, sich auf den Exportmärkten zu behaupten — zur politisch-ökonomischen Konfliktentwicklung keine Antwort bereit hat. Die Schweiz ist heute offensichtlich nicht mehr in der Lage, eine «Tagsatzungsdelegation» wie 1802 zu stellen, die mental in der Lage wäre, das Anliegen der Trump-Administration als europäische Sisterrepublik aufzugreifen und in einen Lösungszusammenhang zu stellen wie einst gegenüber Napoleon und seinen Ideen zur Umkrempelung der Eidgenossenschaft, die er dann einsichtig zurückzog. Die Schweiz nimmt Teil an der internationalen Arbeitsteilung und am Handel auf der Basis des gegenseitigen Vorteils. Die Schweiz war nie eine Kolonialmacht.
Die Kolonialländer haben früh damit begonnen, das innere Ungleichgewicht zwischen Produktion und Konsum durch Expansion auf fremde Märkte zu lösen. Sie haben auch unter sich Krieg geführt um die Aufteilung der Beute.
Die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt Kriege geführt, um ihre wirtschaftliche Expansion voranzutreiben von Indochina bis zur Ukraine heute. Dabei haben die letzten sieben Kriege, die nach 9/11 von den Neocons konzipiert wurden, die USA an Grenzen geführt, die einen Zusammenhang zeigen zwischen der bisherigen globalen Expansion und dem Niedergang der Industrie innerhalb der USA. Zudem haben sich die BRICS-Staaten schneller entwickelt als erwartet. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Vor 200 Jahren ging die Monroe-Doktrin davon aus, dass der amerikanische Kontinent den Amerikanern gehöre und die europäischen Kolonialmächte dort nichts mehr zu suchen hätten. Es ist eine Doktrin, die Trump gewissermassen aufnimmt, wenn er den amerikanischen Kontinent als ökonomisch-politisches Machtzentrum neu stärken will und dabei die Kriegslasten des Ukrainekonfliktes der EU überbinden will. Auch die EU steht vor einem Rückzug, nachdem sie versuchte, in den AKP-Staaten ihre koloniale Herrschaft noch fortzusetzen. Doch auch Frankreich muss Afrika verlassen. Die Bildung der BRICS-Staaten-Gemeinschaft hat nun dazu geführt, dass die einzige Weltmacht und die europäischen Verbündeten sich immer noch im Geist der regelbasierten Ordnung zu sammeln versuchen und sich auf drei Hauptkonfliktzonen konzentrieren, auf die Ukraine, den Nahen und Mittleren Osten und auf das Südchinesische Meer.
Der von den US-Neocons und den Globalisten zu verantwortende Ukrainekonflikt folgt nach wie vor dieser Pfad-Logik, den die europäischen Willigen nun gegen den Willen ihre Bevölkerung fortsetzen möchten und deshalb alles unternehmen, die ausfallenden kolonialen Früchte durch eine Expansion nach Osten zu ersetzen. Sie folgen dabei der fatalen Logik des Ostfeldzuges Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Trump erteilt diesen Expansionsinteressen der EU insofern eine Absage, als er die Erneuerung der produktiven Basis vorwiegend der USA auf dem amerikanischen Kontinent anstrebt. Dies liegt ausserhalb der kolonialen Denktradition Europas und ganz besonders liegt dieser Rückzug der produktiven Basis in die USA nicht im Interesse der Neocons.
Damit stehen in der US-Politik zwei gesellschaftspolitische Entwicklungen gegeneinander: eine rationale Politik, welche die USA aus der Verschuldung herausführen und auf eine stabile wirtschaftliche Basis stellen will, und jene neokoloniale Politik, die gegen die BRICS-Staaten Krieg führen und mittels der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten Fakten schaffen will, um dann sich gegen China zu richten und auf diese Weise die alte Herrschaft zu sichern. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Die neutrale Position – ein im geschichtlichen Prozess erworbener Standpunkt
In der Schweiz haben jene, die in der Tradition der schweizerischen Neutralität stehen, die Ausdehnung der NATO nach Osten als einseitigen Schritt erkannt, der zum Konflikt mit Russland führt. So der schweizerische Generalstab 1993 und 2014 die der Neutralität verpflichteten Politiker, die die Übernahme der Sanktionen der USA gegen Russland durch die Schweiz offen kritisiert haben
Damit wird eines deutlich: Eine aufgeklärte und neutrale Sicht auf die Geschehnisse hat die Schweiz befähigt, die Konflikte im Status nascendi schneller und besser zu verstehen als viele Konfliktbeteiligte. Diese politische Wachheit und über die Jahrhunderte erworbene Befähigung, aus neutraler Sicht aufkommende Konflikte richtig einzuordnen, war eine der Voraussetzungen, nicht gleich unter die Räder der Konfliktentwicklung zu geraten. Die flachen dezentralen inneren Strukturen der Schweiz haben auch eine Industrialisierung befördert, die sogar die Kolonialmacht England aufgeweckt hatte, sodass das Unterhaus John Stuart Mill im 19. Jahrhundert beauftragte, sich mit der Schweiz zu befassen, um zu ergründen, woher die Konkurrenzfähigkeit der Schweiz auf internationalen Märkten rührt. Die flachen Strukturen eines dezentralen, guterschlossenen Dorfnetzes sicherten die Wohnungs- und Ernährungsfrage, ohne dass Wanderungen und teure Metropolenbildung notwendig waren, wie sie in den Ländern mit ausgeprägt feudalen Strukturen und entsprechenden Bodeneigentumsverhältnissen vorherrschten. Deshalb konnte sich die Schweiz früh einen absoluten Freihandel leisten, ohne eine merkantilistische Politik zu betreiben, da die flachen und dezentralen Strukturen den Wohlstand ausreichend sicherten. Ein Problem tauchte erst mit dem wegfallenden Entfernungsschutz auf, der in der Schweiz mit dem Ausbau des regional ebenfalls dezentralen Eisenbahnnetzes den Ackerbau brachlegte. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Damit war eine Grundfrage der Raumentwicklung angesprochen, die im Ergebnis des Ersten Weltkrieges die Entwicklung des inneren Marktes der Länder fördern wollte sowie durch einen Griff auf die eigenen Grundlagen einer umfassenden Wohlstandsentwicklung der Volksgemeinschaften die Ursachen der Krisen zu beseitigen. Diese Fragen wurden im 20. Jahrhundert durch die Innenkolonisation wieder aufgegriffen, um die Fehlentwicklungen zur Metropolenbildung und der Verlagerung der Ernährungsgrundlage an Standorte ausserhalb des eigenen Lebensraumes durch eine innenkolonisatorische Ordnung zu beheben.
Die Schweiz hat zur Frage der von der Trump-Regierung aufgeworfenen Fragen der Handelsbilanz aus ihrer Entstehung und Geschichte heraus eine aufgeklärte und neutrale Sicht, die sie als Antwort auf die Zollforderungen der USA öffentlich vertreten sollte. Wie kann ein Land wie die Schweiz sich gewerblich und industriell entwickeln, ohne seine Geschichte, seine kulturellen Grundlagen zu verlieren und nicht durch eine metropolitane Entwicklung bis zur übermässigen Überfremdung völlig entstellt zu werden? Denn Letzteres hängt mit dem Dienstleistungsexport der USA zusammen, der seinerseits mit der Stellung des Dollars als bisherige Weltwährung zusammenhängt.
Die USA zwischen republikanischer Vernunft und eschatologischem Faktenschaffen
Da die USA realisieren, dass ihre Vormachtstellung im Sinne der «einzigen Weltmacht» (Brzeziński) nicht mehr durchzusetzen ist, liegt die Rolle eines Primus über die anderen Mächte nahe, die untereinander so austariert werden sollte, dass den USA aufgrund ihrer Weltinsellage (Mackinder) eine bleibende Vormachstellung zukommt. Panama, der ‘Golf von Amerika’, Mexico, Kanada und Grönland werden zum Kerngebiet der USA gezählt. Die USA versuchen eine Aufteilung der Welt in Regionalmächte zu regulieren, die sich in den BRICS-Staaten jedoch bereits zusammengefunden haben. Entgegen dem bisherigen kolonialen Konzept des Wertewestens wollen die BRICS-Staaten das Prinzip des gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteils entwickeln.
Die Neocons (Nuland, Kagan etc.) wollen mit dem von ihnen inszenierten Ukrainekonflikt die Verbindung zwischen Russland und vorwiegend Deutschland verhindern. Mit ihrem Konzept der sieben Kriege bekämpfen die Neocons ein starkes Eurasien, weder Russland/Deutschland noch Russland/Iran dürfen sich entwickeln. Amerika soll nach dem Willen der Neocons weiterhin den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten führen. Aber Trump und MAGA möchten jetzt eine Atempause und zuerst die USA auf ihrem kontinentalen Standort stärken. Entsprechend versuchen die USA die BRICS-Staaten durch eine Konfliktstrategie des divide et impera an der Intensivierung der wirtschaftlichen Kooperation zu hindern. Die in Bezug auf Russland entwickelte Over-extending-Strategie soll dann auch auf China und die übrigen «Raubtiere» ausgedehnt werden. Deshalb der hemmungslose Wechsel zur «Dschungel-»(Borrell) bzw. «Raubtierdoktrin». Es ist ein beispielloser Niedergang europäisch aufgeklärten Denkens. Es geht um immer dreistere Versuche, die Völker in die Unmündigkeit zurückzudrängen. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Zwei Argumentationen der besonderen Art seien hier herausgegriffen. Zurzeit wird eine Klärung der Ursachen des Ukrainekonfliktes als Lösungsweg zu einem dauerhaften Frieden abgelehnt. Konflikte können jedoch nur gelöst werden, wenn die Konflikte auf ihre Ursachen zurückgeführt werden. Die Koalition der Willigen will unter keinen Umständen die Entstehung und den Hergang des in der Ukraine ausgetragenen Konfliktes offenlegen und die Ursachen erörtern. Doch wer Frieden will, darf sich nicht gegen eine offene Diskussion über Entstehung und Verlauf des zu lösenden Konfliktes stemmen. Allein schon die in der EU praktizierte Zensur der russischen Medien zeigt, wie weit das staatliche Gewaltmonopol zur Meinungsmache bereits missbraucht wird. Der freie Meinungsbildungsprozess ist nicht mehr gewährleistet. Der Krieg wird auf den öffentlichen Meinungsbildungsprozess ausgedehnt. Das Medienmonopol entscheidet, was Fakten sind. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Mit diesem Ermächtigungscoup wird der Diplomatie, der Erörterung der Kriegsursachen durch mediale Zensur der Boden entzogen. Anstatt den Konfliktprozess zu klären, die Standpunkte der Konfliktparteien offen gegeneinanderzustellen und anschliessend daraus nach den möglichen Lösungen zu suchen, verlangt die Koalition der Willigen, den Konfliktprozess einzufrieren, ihn gewissermassen aus der Zeit zu nehmen und dabei auch die Ursachendiskussion aufzuschieben. Doch der Konflikt als Prozess läuft real weiter. Auch wenn Waffen schweigen, läuft die Rüstung weiter, werden Lager aufgefüllt, werden Waffen in Stellung gebracht, werden weiter Waffengänge vorbereitet. Der Ruf nach einem Waffenstillstand wird jedoch dann zur reinen, hinhaltenden Fiktion, wenn gleichzeitig die Bedingungen des Friedensschlusses einseitig festgelegt werden, ohne dass vorgängig die Ursachen des Konfliktes erörtert und geklärt werden. Dies führt nicht zu einem dauerhaften Frieden, im Gegenteil, es erweitert die mediale und verdeckte Kriegsführung, die Einmischung in die Politik von aussen, das in Stellungbringen von Waffensystemen, die Russland von Anfang an als unzulässiges Vorrücken der NATO kritisiert hat. Hier liegt der Kern des Problems.
Wenn es so wäre, dass die NATO-Osterweiterung und der Bau der Raketenbasen in Polen und Rumänien und die Einmischung in die Politik der Ukraine als Abwehr des Westens gegen eine Bedrohung durch Russland erfolgt wären, dann hätte man ja auf die an der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007 vorgebrachten Bedenken eintreten können. Stattdessen hat Obama offiziell verkündet, diese Basen seien zur Bekämpfung der Bedrohung aus dem Iran gebaut worden.
Als dann 2014 die gewählte Regierung Janukowitsch mit massiver Einmischung der USA in der Ukraine weggeputscht wurde und der russische Militärstützpunkt ebenfalls an die NATO zu fallen drohte, wurde die Krim durch ein Plebiszit an Russland angegliedert.
Das Nichtanerkennen des selbst nachweislich geprägten Konfliktprozesses in der Meinung, man könne auf die eigene Übermacht zählen und man habe infolgedessen eine Klärung auf Augenhöhe mit der bedrohten bzw. gegnerischen Partei nicht nötig, geht von offensichtlich asymmetrischen Regeln aus. Man glaubt, wenn die Strategie des «overextending Russia» nicht aufgehe, stattdessen auch nach mehrmaligen Aufforderungen Russlands nach einer Verhandlungslösung nun gleichzeitig Anspruch auf einen sofortigen Waffenstillstand zu haben.
Nur die klare Offenlegung der Konfliktursachen erlaubt es, einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu finden. Dies umso mehr, als die Klage, es zeichne sich ein Diktatfrieden ab, von den verspielten Konfliktlösungsmöglichkeiten abzulenken versucht und für diese Unterlassungen keine Verantwortung übernehmen will. Wer Verhandlungsangebote ausschlägt und anschliessend in eine schlechtere Position gerät, muss erkennen, dass dann nur noch eine Verständigung über die schonungslose Offenlegung der Konfliktursachen und darauf aufbauend die Suche nach einer stabilen Lösung möglich bleibt.
Der Meinung, man könne den Konfliktprozess zeitlich anhalten, entspricht auch die Vorstellung, man käme zum Frieden, indem man den Konfliktprozess als quasi ungeschehen auf Feld 1 zurücksetzt. Russland müsse sich auf die Grenzen von 2014 (gemeint ist die Krim) bzw. auf die Grenzen vom 24. Februar 2022 (Ostprovinzen) zurückziehen, denn der Krieg habe mit dem «Überfall» Russlands auf die Ukraine begonnen. Doch die ukrainische Armee hat nach dem Putsch vom 27. Februar 2014 gegen landeseigene Provinzen Krieg geführt. Der Krieg ist innerhalb der Ukraine seit 2014 von der ukrainischen Armee gegen Teile der Ukraine, die russisch sprechenden Ostprovinzen, auf deren Wohngebiete begonnen worden. Nebenher liefen Dekrete, die die russische Sprache verboten haben und die Einstellung der Rentenzahlungen an die Bevölkerung der ukrainischen Ostprovinzen erliessen. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
In der NZZ vom 16. August 2025 wird die Aussage Putins, die Friedensverhandlungen müssten die Ursachen des Krieges beseitigen, aufgegriffen: «Aber dafür müssten zunächst ‚die ursprünglichen Gründe der Krise‘ beseitigt werden. Diese Formulierung wiederholt Putin immer wieder. Er meint mit diesen Gründen im Endeffekt die Existenz einer souveränen und freien Ukraine.» Mit dieser zitierten Auslegung, was Putin meint, geht auch die NZZ von der rein legalistischen Trennung der Staatsgrenze von der Volkssouveränität aus. Die Volkssouveränität erlaubt jedoch nicht, innerhalb der Staatsgrenzen der Ukraine durch Einmischung von aussen und durch einen Putsch in den politischen Prozess des Landes einzugreifen, ihn mit anderen Inhalten zu füllen und gleichzeitig in Anspruch zu nehmen, die Staatsgrenze seien dazu da, diesen mit Dollar finanzierten Übergriff auf die Volkssouveränität absolut zu schützen, sodass das Eingreifen Russlands in den gegen die russische Bevölkerung geführten Bürgerkrieg in den Ostprovinzen als Zerstörung der Friedensordnung allein Russland in die Schuhe geschoben werden könne.
In dieser Denkweise wird auch der Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands, die Auflösung des Warschauer Paktes und die Zusicherung, die NATO nicht weiter gegen den russischen Vertragspartner auszudehnen, ausgehöhlt mit dem Argument, diese Abmachungen würden gegen das Recht der freien Bündniswahl verstossen, seien also hinterher als ungültig zu betrachten. Auch sind Klagen wegen der Nichteinhaltung der Abmachungen des Budapester Memorandums nicht schlüssig, wenn nicht gleichzeitig die Abmachungen, die NATO nicht weiter gegen Russland auszuweiten, in diese Diskussion einbezogen werden.
Brutales Faktenschaffen gegen die Vernunft
Wie die Menschen zusammenleben, bestimmen sie selber als souveräne Gemeinschaft. «Jede äussere Intervention ist ein Skandal, weil sie, indem sie die Autonomie aller Staaten in Frage stellt, die Rechte eines von keinem anderen abhängigen Volkes verletzt.» (Ingeborg Maus, Menschenrechte, Demokratie und Frieden – Perspektiven globaler Organisation S. 139.) Wenn also nach der Auflösung der sozialistischen Staatengemeinschaft die betroffenen Völker die Erfahrung der Ausplünderung durch fremde Investoren machen, dann ist ihnen gegeben, sich auf dem Maidan gegen die Oligarchen, die sich das Volksvermögen angeeignet haben, politisch zu organisieren. Ganz klar nicht erlaubt ist jedoch die Intervention von aussen durch die Neocons der USA, welche mit ganz erheblichen finanziellen und organisatorischen Mitteln in der Ukraine die Maidan-Bewegung nach ausländischen Eigentümerinteressen zu bestimmen und umzulenken begannen. Die Scharfschützen auf dem Maidan und der Putsch gegen die gewählte Regierung haben die Souveränität des Volkes verletzt. Die Konfliktentwicklung ist die Folge, wie oben dargelegt. Die Unverrückbarkeit der Grenzen oder die Bündnisfreiheit können hinterher nicht angerufen werden, solange die Souveränität des Volkes nicht wiederhergestellt ist.
Regelbasierte Ordnungen dürfen sich nicht nur auf Einhaltung von Staatsgrenzen beschränkt und die Übergriffe und Verletzung der Volkssouveränität ausser Acht lassen.
Die Handelspolitik von Trump: Irrtum oder Wille zur hegemonialen Neuordnung
Mit der konfliktreichen Frage der Marktausdehnung und der Expansion der politischen Kontrolle der Märkte ist auch die Frage der Handelsbilanz verknüpft. Bereits in der Zeit von 2017 bis 2020 hatte der amerikanische Präsident verlangt, dass die negative Handelsbilanz der USA und die wachsenden Schulden behoben werden müssten. Denn eine negative Handelsbilanz im Bereich der Güterproduktion macht das Imperium abhängig von fremden Lieferungen und schwächt die Bewegungsfreiheit des Raubtiers — eines der geopolitischen Hauptkriterien im Kalten Krieg. Das sollte vorerst nicht öffentlich angesprochen werden. Im Gegenteil, man bekam den Eindruck, man wollte darüber ganz bewusst nicht reden. Die Nebelpetarde bestand darin, sich über Trump lustig zu machen. «Trump irrt mit seiner Handelspolitik», NZZ, 31. März 2025, S. 22.
Die Autoren zitieren Trump: «Unsere Handelsbilanzdefizite zerstören Amerikas wirtschaftliche Zukunft». Sie unterstellen Trump, „in der merkantilistischen Tradition“ zu stehen. Allein dieses rein wirtschaftswissenschaftliche Fehlurteil hat kein Geringerer als Heiner Flassbeck treffend geklärt: „Trumps Zollpolitik schien vielen wie ein Relikt aus einer anderen, einer alten Welt. Sie war aber konsequent. … Dass man als Protektionist beschimpft wird, wenn man sein Handelsdefizit verringern will und gegen Merkantilisten vorgeht, zeigt allerdings, auf welch unterirdischem Niveau die ganze Diskussion geführt wird.“ [H.F., Grundlagen einer relevanten Ökonomik, 2024].
Aufruhr zu diesem ökonomischen Thema, das der einzigen Weltmacht Sorgen zu machen begann, gab es bereits 2004 durch einen Aufsatz von Paul Samuelson im «Journal of Economic Perspectives». Samuelson, Nobelpreisträger, MIT-Ökonom, bekennender „centrist Democrat“ gab zu bedenken, die amerikanischen Konsumenten könnten nicht ewig im Walmart billig einkaufen, wenn die USA die materielle Produktion und auch den informellen Bereich an globale Billigstandorte auslagerten. «Das ist jetzt ein heißes Thema, und im kommenden Jahrzehnt wird es nicht verschwinden“! So kam es denn auch.
Doch die Autoren der NZZ ordnen das US-Handelsbilanzdefizit unnachgiebig in ihr eigenes Freihandelsverständnis ein: „im Handel mit Dienstleistungen, etwa mit dem Verkauf von Softwarelizenzen, Hollywood-Filmen oder Netflix-Abos“ hätten die USA immer noch einen Exportüberschuss. (!) Auch weisen sie darauf hin, ungleiche Handelsbilanzen seien im Kontext der internationalen Arbeitsteilung zu sehen, die durch den allen Handelspartnern zugutekommenden komparativen Kostenvorteil wieder zum Ausgleich kämen.
Demgegenüber begründete Samuelson seine Warnung schon vor 20 Jahren damit, „die ricardo‘sche Theorie der komparativen Vorteile vollständig und richtig interpretiert“ zu haben. Diese enthalte einige „wichtige Einschränkungen“ gegenüber den Argumenten der Globalisierungsbefürworter.
Schon im berühmten Beispiel, Portugal habe einen komparativen Kostenvorteil beim Wein und solle deshalb die Textilproduktion England überlassen, steckt das Problem, dass der Weinbau der begrenzten Bodengrundlage unterliegt und deshalb im Gegensatz zur industriellen Tuchproduktion wirtschaftlich nicht wachsen kann. Ebenso kann ein Handelsbilanzüberschuss im Bereich der Dienstleistung das Handelsbilanzdefizit in der Güterproduktion letztlich nicht aufwiegen, weil jede Dienstleistung nur aufgrund einer Freistellung von der materiellen Produktion möglich ist und somit von dieser abhängig bleibt. Wenn also die USA die Werkbank nach China verlegen, muss die in den USA zu entwickelnde Dienstleistung aus der in China liegenden produktiven Basis finanziert werden. Da dieser Werttransfer jedoch — wie Samuelson rechtzeitig gewarnt hatte — mit der Zeit abnimmt, haben die USA immer einseitiger auf den Dollar als Weltwährung gesetzt, der es ihnen erlaubt hat, den Import mit der Geldschöpfung aus dem Nichts zu finanzieren. Mit der FED-Politik von Greenspan wurde die Entwicklung der Dienstleistung in den USA finanziert. In jener berühmten West-Point-Rede fasste Obama diese Entwicklung so zusammen, dass nicht nur die Dollarherrschaft gesichert sei, sondern dass die USA mit ihrem Soft Skill der Welt stets eine Nasenlänge voraus seien und darauf ihre Herrschaft sichern könnten.
Trumps Kritik an der negativen Handelsbilanz hat erkannt, dass die Sicherheit der Vormacht, in der sich Obama noch wiegte, aus den oben dargelegten Gründen abnimmt.
Die NZZ-Kritik an Trumps Postulaten gibt sich ‘willig’, den sich zuspitzenden Konflikt im Geiste des EU-Europas lieber militärisch auszutragen, anstatt ihn lösen zu wollen. Es geht also doch, wie der NZZ-Artikel bereits erkennen liess, um die Fortsetzung wirtschaftlicher Interessen durch den Krieg. (Siehe auch NZZ vom 23. August 2025, «Was in diesem Krieg zählt»). Was sind denn die Ursachen, dass wirtschaftliche Interessen sich bekämpfen, anstatt zu kooperieren, um den Wohlstand zu heben? Dies ist eine Frage, die sich die BRICS-Staaten, aber immer mehr auch die Bevölkerung Europas stellen.
Präsident Trump hat seine damalige Forderung in der jetzigen Amtszeit nochmals deutlich wiederholt und das strategisch für die USA zu beseitigende Handelsungleichgewicht im Bereich der materiellen Produktion in plakative Zölle umgerechnet, die zu erheben die USA als Leidtragende berechtigt seien, um ihre Handelspartner zur Kooperation zu zwingen.
Wenn eine Weltmacht so reagiert, hat das Gründe. Denn schliesslich fungiert der Dollar als Weltreservewährung, seit der Goldstandard 1971 durch Präsident Nixon aufgehoben werden musste und durch den Petrodollar ersetzt wurde. Damit war der Weg zur permanenten Geldschöpfung durch die USA frei. Die 700 Militärbasen weltweit konnten damit finanziert werden, ohne dass die US-Wirtschaft diese Lasten selbst tragen musste.
Die anschliessende Verlagerung der Güterproduktion hauptsächlich nach China hat den Konsum verbilligt. Zusammen mit der abwandernden Industrie drohte jedoch beinahe eine Deflation, sodass der Vorsitzende der FED, Alain Greenspan, die Tiefzinspolitik durchsetzte, um einen Konsum- und Immobilienboom in Gang zu setzen, der die Aufgabe hatte, die wirtschaftliche Umgebung der verbliebenen Rüstungsindustrie und des im Silicon Valley anhebenden Soft Skills als Hauptelemente der globalen Vorherrschaft vor konjunkturellen Störungen zu schützen und sich so in einem günstigen Umfeld entwickeln zu lassen.
Doch diese Form der Vorherrschaft begann sich seit Aufkommen der BRICS-Bewegung als instabil zu zeigen. Einerseits wurde die «Werkbank» China schneller als erwartet zum Konkurrenten. Die nun in den USA fehlende industrielle Fertigungstechnik im eigenen Land zusammen sowie der steigende Schuldendienst wurden als limitierende Faktoren erkannt, die dann erst recht wirksam werden, wenn die Dollarherrschaft mit der Zeit verloren geht.
Unter diesen Umständen versuchen die USA sich kontinental zu reorganisieren, Kanada, Grönland, den Panamakanal fester an sich zu binden, Brasilien als BRICS-Mitglied zurückzubinden, die Fertigungsindustrie zurückzuholen und die Kriegslasten der letzten sieben Kriege auch auf das nun durch den Stellvertreterkrieg in der Ukraine dem angrenzenden EU-Europa aufzubürden. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Die «Zölle» sind deshalb nichts anderes als ein Sanktionsmittel, um eine neue Ordnung der Dependenz zu erzwingen, eine wirtschaftlich als «Zollstreit» verkleidete Massnahme.
Die ökonomische Kritik an Trumps Vorgabe, die negative Handelsbilanz zu korrigieren, geht am Kern des Zollhammers vorbei. Der Vorwurf, die Massnahmen zur Behebung des Handelsbilanzdefizites seien ein Rückfall in den Merkantilismus oder die Zölle würden die Inflation in den USA anheizen, dient allein der Unkenntlichmachung, worum es geht. Abgesehen davon ist das Streben nach einer ausgeglichenen Handelsbilanz eben nicht Merkantilismus, sondern letztlich die Forderung nach einer ausgeglichenen Wohlstandsentwicklung, die ja auch ein Ziel der BRICS-Staaten ist.
Weil die EU die europäische Verantwortung nicht eigenständig wahrnimmt und die Chance nicht ergreift, zwischen den USA und den BRICS zu vermitteln, bleibt die EU weiterhin in der Abhängigkeit der USA. Der Aufforderung Trumps, dass die EU an ihrer Ostgrenze den Konflikt in der Ukraine in die eigene Verantwortung übernehmen und diplomatisch lösen soll, kommt die EU unter dem Diktat der Willigen nicht nach. Vielmehr schmieden sie Kriegspläne, um den Konflikt fortzusetzen. Sie stellen sich dabei gegen Trump und folgen deshalb dem Konzept der Neocons, Russland von Europa getrennt zu halten. Trump möchte mit Russland insoweit eine Verständigung, um sein MAGA-Konzept schnellstmöglich zu realisieren. Die europäischen Staaten sollen dabei je nach ihren finanziellen Möglichkeiten in die Tasche greifen. Das Zurückholen der produktiven Industrie in die USA ist ein rationales Projekt. Es löst das bisherige Projekt der Neocons, die einzige Weltmacht anzuführen, ab. Die EU steht vor der Wahl, entweder die Verständigung zwischen den USA und Russland zu unterstützen und dabei den USA bei ihrem Weg aus der Schuldenfalle und aus dem Rückgang des Dollars als Weltwährung durch geeignete Wirtschafts- und Geldreformen behilflich zu sein — oder aber durch die Fortführung des Krieges durch Waffenkäufe und Waffenproduktion die eigene Wirtschaft und den Wohlstand zu ruinieren und auch Russland zu schwächen. Das dient jedoch dem Konzept der Neocons, die Konfliktstrategie in der Ukraine, im Nahen Osten und gegen China ungehindert fortsetzen zu können. Dieser geradezu eschatologische Züge annehmende Kriegswille der Neocons will den Nahen Ostens mit Hilfe der USA zum Weltzentrum ausbauen.
Die von den Neocons eingefädelte Osterweiterung der EU und der Nato mit der Strategie des overextending-Russia kippt nun zurück in ihr Gegenteil: In Turnberry wurde der EU zugunsten der USA ein enormer wirtschaftlicher Aderlass aufgezwungen. Dies ist nun wirtschaftlich gerade das Gegenteil dessen, was die EU bisher mit ihrer militanten Osterweiterung unter dem erweiterten NATO-Schirm anstrebte, nämlich wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, — allerdings zum wirtschaftlichen Nachteil der Ukraine, was Präsident Janukowitsch ablehnen musste.
Die 2001 von Putin im Bundestag vorgeschlagene wirtschaftliche Kooperation haben sich Deutschland und die EU von den politisch umstrittenen US-Neocons aus den Händen nehmen lassen. Dies wurde durchgesetzt einerseits durch die NATO-Osterweiterung und auf politischer Ebene durch die damals 2013 der Ukraine vorgeschlagenen EU-Verträge, welche der NATO direkt den Zugriff auf die Krim erlaubt hätten. Deutschland, das aus seinem gescheiterten Ostfeldzug im Zweiten Weltkrieg hätte lernen sollen, liess sich von den in Osteuropa wirkenden US-Neocons einbinden in die Strategie des «overextending-Russia». Dabei gehörte die Perspektive der künftigen wirtschaftlichen Kooperation mit Russland zum Kern der deutschen Wiedervereinigung. Die klare Ablehnung der «Friedlichen Koexistenz» der 70er Jahre durch den Westen sollte durch die Friedensdividende, also durch eine friedliche wirtschaftliche Kooperation zum erklärtermassen gegenseitigen Vorteil überwunden werden.
Gold ist ein Zahlungsmittel. Aktuell läuft der seltsame Versuch, auf Goldtransporte Zölle zu erheben, Vorbote einer Geldreform? Auch die Neutralität steht als Wert unter grossem Druck. Die Neocons haben 2013/2014 der Schweiz die Preisgabe der umfassenden Neutralität im Rahmen der OSZE-Zusammenkünfte abgepresst.
Wenn nun erst Monate nach der Präsentation der Zolltafel im Rosengarten die Diskussion um das effektive Handelsbilanzdefizit zwischen den USA und der Schweiz mit 40 Mrd. $ zu Lasten der USA beziffert wird, dann stellt sich doch als Erstes die Frage, warum dieser Betrag nicht längst geprüft und gegenseitig bestätigt wurde? Man kann doch Ausgleichs- bzw. -Kompensationsangebote sinnvollerweise nur diskutieren, wenn klar ist, welche Schadensentwicklung auszugleichen ist. Dabei geht es um die Güterproduktion und nicht um die Dienstleistung.
Bei der zu prüfenden Bilanz stehen Wertschöpfungen, die in der Schweiz erbracht wurden und an Kunden in den USA verkauft wurden, solchen, die in den USA erbracht und in die Schweiz verkauft wurden, gegenüber.
Im Güterverkehr werden also nur die im jeweiligen Land erbrachten Leistungen gegeneinander abgewogen.
Dass offenbar Goldverkäufe aus der Schweiz in die USA betragsmässig den Löwenanteil des Handelsungleichgewichts ausmachen, wurde nun erstmals öffentlich gemacht, nachdem Präsident Trump am 1. August den für die Schweiz zur Anwendung kommenden Zollsatz von 39% eröffnet hat. Eigentlich sollte diese Klärung längst stattgefunden haben. Oder aber sie wurde unterlassen, weil Ziel und Gegenstand der Verhandlung mit den USA zum vorneherein auf finanzielle Abgaben der reichen Schweiz an die USA zielten, deren genaue Verwendung jedoch erwünschtermassen im Unklaren bleiben sollten wie die ökonomisch klare Begründung des Handelsdefizites selbst. Denn wenn das Handelsdefizit in Bezug auf die Schweiz auch wegen der äussert beschränkten Basis der aus der Schweiz exportierenden gewerblich/industriellen Leistungen vorgängig als vernachlässigbar erklärt worden wäre, dann hätte sich die Frage gestellt, wie die USA im Falle der Schweiz ihre Forderungen begründen wollen? Nach US-Handelsminister Howard Lutnick (siehe NZZ vom 10. September 2025) ist jedoch entscheidend, wie reich das Land ist, das zu Abgaben herangezogen werden kann. Es ist die gleiche Logik, die Stuart Eizenstat schon vor 25 Jahren gegen die Schweiz vertreten hat.
Die gewerbliche Leistung des Umschmelzens von Gold beim globalen Goldhandel ist gegenüber dem Wert des Rohmaterials, das in die Schweiz geliefert wird, unbedeutend. Umgekehrt ist es bei den Erzeugnissen des Gewerbes und der Industrie: Dort stehen zugekaufte Rohstoffe und zugelieferte Komponenten in einem vernachlässigbaren Verhältnis zu den Herstellungskosten. Bemerkenswert ist auch, dass Richard Saynor der Sandoz «die Zollproblematik [als „eine Nebelwand, die den Blick auf die wahren Probleme versperrt“, bezeichnet. NZZ, 8. August 2025, S. 23. XXX
Eine Zeitlang schien diese unselige Golddiskussion wie von Zauberhand beseitigt. Die Zölle auf Goldlieferungen hat Trump wieder fallen gelassen. Rätselhaft, warum das Seco mit seinen Ökonomen nicht bereits im April geklärt hat, was bei dem behaupteten Handelsbilanzüberschuss der Schweiz zu den USA überhaupt angerechnet werden darf. Gold ist ein Zahlungsmittel. Dass die Verzollung von Gold überhaupt Gegenstand der Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA sein konnte, bestätigt, dass es nur um Geldforderungen der USA an die Schweiz geht. Inzwischen flammt diese Golddiskussion wieder auf.
Wie den Verlautbarungen des Bundesrates damals zu entnehmen war, scheint ihm das am 31. Juli 2025 von Präsident Trump vorgebrachte Argument des Handelsdefizites von 40 Mrd.$ und die daraus abgeleitete Forderung nach einem deshalb bedeutend grösseren «Entgegenkommen» neu zu sein (siehe Tagesschau SRF vom 1. August). Daraus muss man schliessen, dass bisher in den Verhandlungen in völligem Einvernehmen mit den USA von viel tieferen Werten ausgegangen wurde. Denn hätte die Verhandlungsdelegation der USA von Anfang an höhere Forderungen gestellt, dann wäre ja die Klärung der Frage des effektiv vorliegenden Handelsdefizites unausweichlich geworden. Damit wäre die politische Akzeptanz des Deals einer steigenden Belastung ausgesetzt worden, eigentlich getarnte Kriegskredite an die USA zu beschliessen und eben nicht, wie öffentlich kommuniziert, eine Kompensation des Handelsbilanzdefizites im Güterbereich.
Doch damit ist dieses komplex aufgegleiste Verwirrspiel noch nicht ausgelotet. Der Zollhammer soll nun auch Druck erzeugen, dass die Schweiz dem Verhandlungsergebnis mit der EU zustimmt. Es gibt Stimmen, die behaupten, die Verhandlungen mit den USA seien deswegen sabotiert worden, um die Schweiz in die Arme der EU zu treiben. Doch inzwischen ist das Verhandlungsergebnis der EU in Turnberry mit derart vielen Fragezeichen und Unwägbarkeiten behaftet, dass die Argumentation, man fahre mit der EU besser, allein schon aus rein finanzieller Sicht kaum besser ist, als wenn die Schweiz von den USA separat für die «Kriegskredite» zur Kasse gebeten würde – entweder durch die Schweiz direkt an die USA oder über die Schweiz als Zahler der EU an die USA. Auch wenn die 39% Zoll im Moment gegenüber den 15% der EU „schrecken“, sind die Nachteile einer Annäherung an die EU nach den vorliegenden Vorschlägen zu den Bilateralen für die Souveränität der Schweiz bedeutend grösser.
Dass unsere Politiker und die oberen Wirtschaftsführer die Brisanz der Trumpschen Politik nicht verstanden haben und von „Irrtum“ redeten, zeigt, dass sie von politischer Ökonomie inzwischen nicht mehr viel verstehen. (Siehe mein Leserbrief NZZ vom 4. April 2025). Was die Schweiz anbetrifft, wollen die USA die Verlagerung der hochklassigen Schweizer Produzenten direkt in die USA. Zweitens wird die Schweiz zum Anschluss an die EU gedrängt, wo sie dann zusammen mit der EU besser am Nasenring geführt werden kann. Drittens würde eine neutrale eigenständige Schweiz gerade im kommenden Jahr, wo sie den OSZE-Vorsitz hat, ‘neutralisiert’. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Also eine Win-win-win-Situation für die USA!
Niemand ausser der Schweiz hat jetzt noch die Möglichkeit, den effektiven Betrag des Handelsdefizites mit den USA zu klären und vor der Weltöffentlichkeit einen begründbaren Zollsatz zu klären — oder aber die überrissenen Forderungen der USA als das zu bezeichnen, was sie sind, ein Fundraising der USA für ihre Kriege. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Denn dass es hier ernst gilt, zeigen die dem «Zollhammer» nachgeschobenen Analysen, die Schweiz sei bereits «NATO-Gelände». ( NZZ 5. August 2025, Nato Defence College in Rom.)
Es gibt noch solche, die meinen, die Schweiz habe Freunde in den USA und daraus ableiten, man habe einen separaten Draht zu Mar-a-Lago. Sie raten davon ab, in Bezug auf das imperialistische Kriegsziel der USA die neutrale Position der Schweiz klarzustellen. Stattdessen solle die Schweiz mit den USA nach wie vor eine einvernehmliche Lösung erarbeiten, gerade so, als seien die Schweiz und ihre Unternehmen in den USA nicht immer wieder abgestraft worden!
Die Schweiz muss sich distanzieren von der Koalition der Willigen in Europa und damit von deren Spiritus Rector, den Neocons. Das setzt aber voraus, dass Mar-a-Lago nicht den Neocons unterliegt. Das ist aber wiederum nur möglich, wenn Europa zwischen den USA und den BRICS vermittelt. Die OSZE, deren Vorsitz die Schweiz 2026 übernimmt, ist das geeignete Format dazu.
Denn die Neocons haben die Schweiz zur Übernahme der Sanktionen gegen Russland zum Schaden der Neutralität gezwungen. Seit dem Eizenstat-Bericht 1997, den nachrichtenlosen Vermögen und der damaligen Diskussion um das Gold ist aus dieser Richtung keine Unterstützung zu erwarten. Andererseits stellt sich nach wie vor die praktische Frage, wie weit setzt Trump diese Politik fort? Nach Turnberry ist klar: Die USA wollen Geld und die Verlagerung von hochwertigen Fertigungsbetrieben und die Pharmaindustrie in die USA. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Geht man von der geostrategischen Neuausrichtung der USA aus, ergibt sich, die USA verlangen namhafte wirtschaftliche Leistungen in Form von Geld, Rüstungskäufen oder Betriebsverlegungen in die USA, angepasst an die jeweilige volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der zu diesen Leistungen aufgerufenen Länder. (Auszeiichnung durch die Redaktion.)
Der Marshallplan und die NATO
Nach dem Zweiten Weltkrieg überschwemmten die USA Westeuropa mit Gütern. Die Handelsbilanz der westeuropäischen Länder war negativ. Die Staaten waren gezwungen, den Negativsaldo mit Goldlieferungen auszugleichen. Die Goldreserven der USA verdoppelten sich in der Folge von 1937 bis 1949, in Westeuropa schrumpften sie um mehr als die Hälfte.
Um dieses Ausbluten aufzufangen, haben die USA den Marshallplan lanciert, teils aus verzinslichen Anleihen, rückzahlbaren Krediten und auch Subventionen. Der eigentliche Deal bestand damals darin, im Gebiet der Hilfsgeldempfänger die NATO aufzubauen.
75 Jahre später: der ‚Deal‘ mit der EU im schottischen Turnberry. Westeuropa soll den von den USA angezettelten Krieg gegen Russland selber übernehmen und finanzieren. In diesen Deal soll auch die Schweiz hineingezwungen werden. Und zwar offensichtlich nach vorhergehender Täuschung des Bundesrates, durch rein wirtschaftlich-handelsmässige Erwägungen im Güterhandelsbereich und nicht, wie nun eigentlich beabsichtigt an den Tag kommt, im militärischen Bereich. Der Vorwurf Trumps, dass die Schweiz die USA mit dem Saldo von 40 Mrd. $ «ausplündere», deutet diese Militanz an, gröberes ‘Geschütz’ aufzufahren.
Es ist die Fortsetzung jener Aktion, in der man die Schweiz bei der Übernahme der Sanktionen gegen Russland ebenfalls ‘überfallmässig’ genötigt hat.
Im bevorstehenden Deal steht die Neutralität auf dem Spiel. Dass die Medien «Brüssel als Vorbild» erwähnen (NZZ vom 4. August 2025), das Problem gar beim ‘Gesprächston’ des Bunderates, bei den Interessen der Chemie oder beim Goldeinschmelzgeschäft (das eine saubere Handelsbilanz gar nicht belastet [was wird da eigentlich verwirrspielmässig gerechnet?]) oder gar bei ‘Konzessionen für den Rindfleischimport’ sehen, ist Ablenkungsmanöver der hegemonialen Regie und gleichzeitig Beleg der Randständigkeit der politischen Elite Europas. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
So wie die Dinge laufen, soll der Weg freigemacht werden für die Eingliederung der Schweiz in die NATO. Ob dies mit oder ohne EU geschieht, schwindet zur Nebensache, denn in beiden Fällen wird die Souveränität der Schweiz wie schon beim Sanktionszwang gegen Russland in der Substanz weiter geschmälert. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Die Kriegsursachen müssen gelöst werden.
Die Lösung kann nur darin liegen, die Ursachen des wirtschaftlichen Expansionszwanges, der zu Imperialismus und Krieg führt, zu beseitigen. Die internationale Arbeitsteilung muss allen Beteiligten zum gegenseitigen Vorteil verhelfen. Aus ökologischen, sozialen und kulturellen Gründen muss die Entwicklung der Arbeitsteilung vorrangig den inneren Markt entwickeln. Entsprechend müssen Produktionsmittel- und Konsumgüterindustrie so ineinandergreifen, dass sie den inneren Markt ohne Krisen und Verwerfungen erweitern können. Damit entfällt der bisherige Zwang zur Expansion und zur einseitigen militärisch abgesicherten Markterweiterung auf Kosten der ausgeplünderten Länder. Denn die Beseitigung von wirtschaftlicher Ausplünderung ist ein Hauptthema, das sogar Trump bei der Zolldiskussion immer wieder anführt.
Die Aufgabe der neutralen Schweiz ist es, einerseits den sich abzeichnenden hegemonialen Übergriff auf ihre Wirtschaft zurückzuweisen und andererseits als neutrales Land vor der europäischen und vor der Weltöffentlichkeit die Diskussion über die Kriegsursachen aus neutraler Sicht aufzuklären. (Auszeichnung durch die Redaktion.)
Der Vorsitz in der OSZE, den die Schweiz als neutrales Land 2026 innehat, ist Verpflichtung.
Zürich, 8. September 2025
*) Hans Bieri, ist Mitglied des Initiativekomitees Neutralitätsinitiative www.neutralitaet-ja.ch und Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung Industrie und Landwirtschaft, SVIL, www.svil.ch, früher «Innenkolonisation».



