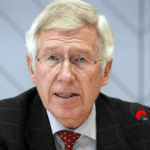Der Verzicht auf Nachrichten – «News-Deprivation» – ein selbstverschuldetes Drama der traditionellen Medien
«Fast die Hälfte der Schweizer:innen (46,4 %; +0,7 Prozentpunkte, PP) zählt 2025 zu den «News-Deprivierten» – also jenen, die selten oder kaum journalistische Nachrichten konsumieren», schreibt das «Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft» (fög) der Universität Zürich in den Hauptbefunden des soeben erschienenen Jahrbuchs 2025 zur Qualität der Medien.[i] Aus dieser Formulierung geht nicht genau hervor, wer weshalb „depriviert“ ist – sich den Nachrichten entzieht. Dieser Frage geht der Autor Heinrich Anker im folgenden Essay nach. Er war zunächst Redaktions-Azubi und einige Jahre Journalist an einer mittelgrossen Tageszeitung, sodann 20 Jahre lang Radiopublikumsforscher und Programmentwickler bei der SRG (von 1989 bis 1997 an der Generaldirektion SRG, von 1997 bis 2008 an der Direktion von Schweizer Radio DRS).
«Qualität bringt Quote!» – das Publikum reagiert höchst positiv auf den Ausbau des Informationsangebots des einstigen Radio DRS
Ende der 1990er Jahre wurde es immer klarer: Mit der fortschreitenden gesellschaftlichen Differenzierung konnte Radio DRS nicht mehr mittels der Schaffung von immer noch mehr Zielgruppenprogrammen Schritt halten. Einerseits fehlte es an den notwendigen Mitteln, anderseits waren die UKW-Frequenzen knapp. Thematisiert wurde auch die Problematik einer Gesellschaft, die infolge von immer mehr Zielgruppenprogrammen in immer mehr in sich geschlossene Bubbles zerfällt, wo doch der Auftrag des Service public in der gesellschaftlich-kulturellen Integration besteht.
Dies führte zu einer kopernikanischen Wende in der Programmpolitik: Es konnte nicht darum gehen, immer noch mehr Zielgruppenprogramme zu entwickeln, sondern die Frage lautete: Was verbindet alle Zielgruppen miteinander und mit welchen programmlichen Leistungen wird Radio DRS über alle gesellschaftlichen Kreise hinweg identifiziert? Was längst schon aus professionellen Überlegungen vermutet wurde, bestätigte auch die Empirie: In Bezug auf Information und Meinungsbildung und in Bezug auf den Beitrag des Radios zur gesellschaftlichen Integration war Radio DRS unangefochtene Spitze. Dies führte zur Strategie «Stärken stärken» statt immer noch mehr Programme.
Das Informationsangebot wurde in der Folge signifikant ausgebaut: Das «Echo der Zeit» wurde wiederum auch am Samstag und Sonntag ausgestrahlt, «International» wurde am Sonntag gleich im Anschluss an das «Echo» gesendet, auf Radio DRS 3 wurde «Info 3» lanciert mit einer Richtdauer von ca. 10 Min.,[ii] und im Anschluss an das «Rendez-vous am Mittag» wurde das «Tagesgespräch» eingeführt.[iii] Der Erfolg war durchschlagend: Nicht nur konnte der seit Jahren hartnäckig anhaltende Publikumsverlust gebremst werden, vielmehr stiegen die Nutzungszahlen auf ein seit Jahren nicht mehr erreichtes Niveau.[iv] Dies ging nicht primär auf Kosten der schweizerischen privaten Radios, sondern der ausländischen. Die Informationsstrategie erwies sich als durchschlagender Erfolg. Wie konnte es in der Zeit danach zur heutigen «News-Deprivation» kommen? Es muss etwas Dramatisches vor sich gegangen sein.
Vom Dienst an Menschen, Gesellschaft und Politik zum Primat von Profit und Quote
Eine wesentliche Erklärung ist, dass der Neoliberalismus als Ideologie des kurzfristigen maximalen Profits in den ca. 25 Jahren zwischen der Jahrtausendwende und 2025 auch die europäische Medienlandschaft vollständig durchdrungen hat.
Die traditionellen privatwirtschaftlichen Medienanbieter (PM)[v] trimmten ihre Unternehmen zwecks kurzfristiger Profitmaximierung auf höchste wirtschaftliche Effizienz (möglichst viel Ertrag mit möglichst wenig Aufwand) und verabschiedeten sich aus ihrer gesellschaftlich-politischen Verantwortung.[vi]
Davon liessen sich auch die Führungsgremien der öffentlich-rechtlichen Medien (ÖRR)[vii] unter Zugzwang bringen: Sie bedienten und bedienen sich derselben neoliberalen betriebswirtschaftlichen Prinzipien der Unternehmensführung wie die PM: «Von der Anstalt zum Unternehmen» lautete nunmehr die Losung bei der SRG. [viii] Ergebnis davon ist u.a. die Zentralisierung in Zürich, Lausanne und Lugano[ix], die Zusammenlegung von Radio und TV[x], die straffe Zentralisierung der Produktion auf Kosten der internen betrieblichen Vielfalt und Kreativität, ergo auf Kosten der Vielfalt des publizistischen Outputs, der publizistischen Reagibilität (aktuelle Sondersendungen) und letztlich auf Kosten des Kerngeschäfts des Service public: Info und Kultur des Radios wurden mit teils vordergründigen Argumenten ausgedünnt, dafür TV-Sport- und Unterhaltung ausgebaut.[xi]
Der einzige Unterschied zwischen PM und den Öffentlich-Rechtlichen Medien ÖRR: Die Richtgrösse Letzterer ist nicht der maximale kurzfristige Profit, sondern die maximale kurzfristige Quote. Die Anwendung derselben betriebswirtschaftlichen Prinzipien des ÖRR wie der PM führte dazu, dass die ÖRR mit den PM in eine Verdrängungskonkurrenz gerieten, wo sie doch früher in einer Ergänzungskonkurrenz zu den PM standen: Die ÖRR sollten ursprünglich jene programmliche Versorgung erbringen, welche andern Anbieter aufgrund mangelnder technischer (!) Abdeckung nicht zu erbringen vermochten. Heute kämpfen die ÖRR mit denselben Leistungen auf denselben Märkten gegeneinander – was die ÖRR in unserer an sich schon neoliberalen Epoche noch zusätzlich unter Druck setzt: Sind öffentliche oder quasi-öffentliche Institutionen schon an sich für die Neoliberalen ein Ärgernis, sind sie es noch viel mehr, wenn sie in denselben Teichen fischen wie die privatwirtschaftlichen Betriebe. Es ist einerseits eine neoliberale Mär zu behaupten, privatwirtschaftliche Unternehmen seien a priori effizienter als öffentliche, anderseits ist die neoliberale Kritik der ungleich langen Spiesse von gebührenfinanzierten und privatwirtschaftlichen Medien nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Die Folgen:
Sahen sich die Medien vor der neoliberalen Epoche primär im Dienste ihres Publikums und der Gesellschaft, stellen sie nun das Publikum in ihre Dienste. Nicht mehr die Frage ist wegleitend: «Wie können wir den Menschen auf dem Weg durchs Leben Hilfestellung bieten?», sondern: «Wie können wir das Publikum als Mittel der Profit- bzw. Quotensteigerung zu immer noch mehr Konsum veranlassen?» Im Zuge der neoliberalen Welle wurde das Publikum vom verantwortlichen Bürger, vom Zoon politicon, zum Konsum-, Profit- und Quotenvieh degradiert, sprich: instrumentalisiert – ein fundamentaler Verstoss gegen das «Eingemachte» der aufgeklärten Ethik: «Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst.» (Kant, 4, 429).[xii]
Die neoliberale Fokussierung auf die rein wirtschaftliche Effizienz führte dazu, dass heute die ganze Problematik der ÖRR allein aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet wird – selbst die SRG versucht, mit Sparmassnahmen dem Hammer der Halbierungs-Initiative der Neoliberalen zuvorzukommen. Damit macht man den Service public hinterrücks kaputt: Er bezieht seine Gebühren genau deshalb, weil er nicht denselben betriebswirtschaftlichen Prinzipien gehorchen soll wie die PM: Die privaten PM sind frei, die Maximierung des Profits als oberste Maxime zu verfolgen (selbst wenn sie sich mit stetigem Leistungsabbau zunehmend selber ruinieren[xiii]), die ÖRR hätten demgegenüber die Pflicht, ihre programmliche Leistung zu fokussieren und zu optimieren. Schon ein Blick in die Jahresberichte zeigt jedoch ein ganz anderes Bild: Es gibt jede Menge finanzieller Kennzahlen, aber weder in der Schweiz noch in Deutschland gibt es ein systematisches verbindliches Raster, mittels welchem der programmliche Auftrag der ÖRR auf messbare oder sonstwie plausibilisierte Leistungsindikatoren (Inhaltsanalysen, Publikumsbefragungen, Expertenberichte…) heruntergebrochen und dessen Erfüllung nachgewiesen wird.[xiv]
Falsche Menschenbilder bei den Programmschaffenden – missverstandene Publikumsbedürfnisse
Dies ist der von den Eigner- bzw. Führungsgremien der traditionellen PM wie der ÖRR gesetzte neoliberale betriebswirtschaftliche Rahmen der Medienbetriebe, innerhalb welchem die Programmschaffenden heute arbeiten. Diese selber sind von andern Kulturen geprägt. Zwei davon haben in der heutigen Welt der traditionellen Medien ganz besonderes Gewicht.
Die erste geht zurück auf Walter Lippmann. Sein berühmtestes Werk ist Public Opinion (1922): Er beschreibt darin, dass die Steuerung der öffentlichen Meinung zu einem wichtigen Werkzeug für Regierungen und Institutionen geworden sei. Er hält Staats-Propaganda in modernen Demokratien für unvermeidlich. Nach seiner Meinung ist die breite Öffentlichkeit nicht in der Lage, komplexe politische Realitäten zu verstehen. Deshalb sei eine „spezialisierte Gruppe von Menschen“ notwendig, um Informationen zu sammeln, zu strukturieren und für politische Entscheidungen aufzubereiten. In diesem Kontext entwickelte er auch das in den Medienwissenschaften legendäre Konzept des Gatekeepers: Journalisten sind Schleusenwärter, die entscheiden, welche Informationen in die Öffentlichkeit fliessen – und welche nicht. Lippmann kann unter gewissen Aspekten als Vorläufer des Neoliberalismus betrachtet werden, vertritt jedoch im Gegensatz zu diesem ein humanistisch-aufgeklärtes Menschenbild. (Staats-)Propaganda zum Zweck des (vermeintlich) Guten und Humanismus sind ein Mix, der für die gemäss Medienprofessor Vinzenz Wyss’ Forschung mehrheitlich linken Journalistinnen und Journalisten attraktiv sein dürfte.
Lippmanns Konzept – «spezialisierte Gruppen von Menschen», gepaart mit humanistischen Idealen -, ist seit Jahrzehnten bei Medienschaffenden bewusst oder unbewusst en vogue und wurde bis zum Ende des Kalten Krieges auch gar nicht als propagandistisch, ja manipulativ betrachtet oder gar hinterfragt. Infolge des Wegfalls des «Erzfeindes» UdSSR 1989 einerseits, anderseits «dank» Corona und der Berichterstattung über den russisch-ukrainischen Krieg wurde die staatspropagandistische Arbeit der traditionellen Medien für eine breite Öffentlichkeit klar erkennbar und seine Konsequenzen erstmals deutlich bis auf individuelle Ebene fühlbar, z.B. in Form von rigorosen Lockdowns während Corona oder Kürzung von Renten zwecks militärischer Aufrüstung: Die Leitmedien vertraten und vertreten beinahe völlig vorbehaltlos die Politik der jeweiligen Regierungen – abweichende Informationen und Meinungen wurden und werden systematisch ausgeklammert und deren Vertreter systematisch übergangen.[xv] Die Folge:
Ein Teil des Publikums fühlt sich von den Leitmedien nicht mehr respektiert, sondern übergangen, ja sogar manipuliert. Das Bild des unterbelichteten Menschen ist fatal: Nicht nur ist dies an sich eine Beleidigung bzw. Provokation der mündigen Bürgerin und des mündigen Bürgers, es ist auch blauäugig zu glauben, diese orientierten sich bloss aus einer einzigen Quelle und es gäbe auch keine Diskussionen in ihrem jeweiligen sozialen Kontext. Ist es erstaunlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Leitmedien (PM und ÖRR) verlieren und sich abwenden?
Die zweite Kultur, die unter Programmschaffenden verbreitet ist: Besonders im Bereich TV und Boulevard – der auch immer tiefer in die «seriöse Presse» eindringt – herrscht eine wahre Emotionsseuche: Die Menschen werden bloss als von Emotionen getriebene Wesen verstanden. Symptomatisch dafür ist etwa, wenn Moderatoren der Tagesschau von Infotainment und Infomotion sprechen. Auch hier wabert ein Bild des Menschen, das nicht frei von Zynismus ist: Der Mensch ist nicht wie bei Lippmann durch Propaganda auf den «richtigen» Weg zu führen, sondern mittels Emotionen zum Medien-Konsum zu ver-führen. Wir stossen nicht auf einen unmündigen, weil unwissenden Bürger, sondern auf einen unmündigen Bürger, der nicht aus eigener Verantwortung Informationen nachfragt, sondern mittels der Möhre «Emotionen» vor der Nase zu etwas verführt werden muss, was er sonst nicht tun würde.
Der Emotions-Approach hat weitreichende Folgen: Nicht die Relevanz der Infos für die Bürgerinnen und Bürger ist das entscheidende Kriterium des Informations-Gatekeepings, sondern das emotionale Erregungspotential (Kriege, Katastrophen, Unfälle, Verbrechen, Skandale, Personen…). Dies führt u.a. dazu, dass es um keine hierarchische Ordnung nach der Relevanz der Informationen geht, sondern um eine inhaltlich unstrukturierte Aneinanderreihung von News-Emotionen; die Dramaturgie der Beiträge ist ebenfalls auf emotionale Anreize ausgerichtet, und auch das Studio-Dekor und die stylish aufgebrezelten, äusserlich attraktiven Moderatorinnen und Moderatoren dienen der Steigerung der Emotionen; dies alles in der Absicht möglichst hoher Quoten als Massstab des «Erfolgs». Die Folge:
Das Publikum erfährt emotionale Dauer-Bombardements. Und weil diese auf die Menschen abstumpfend wirken, wird das emotionale mediale Dauerbombardement sukzessive aggressiver. Irgendwann führt diese Steigerungsspirale zur emotionalen Erschöpfung der Menschen. Zynismus ist die Folge: Die Menschen haben den Eindruck des Déjà vu und langweilen sich mit der Zeit oder sie fühlen sich durch die Medien instrumentalisiert, ja gemobbt – sie haben genug und wenden sich ab.
Die Quote macht Angst und lähmt Kreativität und Innovation
Ein weiteres Phänomen, das der Schreibende als Medienreferent bei Radio DRS beobachtete: Niemand lästerte in der Öffentlichkeit lauter über die Quoten als die Leiter von Info-Sendungen, aber niemand konsultierte ihn auch öfters als diese. Eine Erklärung: Wo die Losung «Pas de Service public sans public!» (ex-Generaldirektor Armin Walpen) lautet, und wo ein unauflösbarer «Spagat zwischen Markt und Auftrag» postuliert wird (Andreas Blum sel.), sehen sich die Programmschaffenden dauernd auf Messers Schneide, getrieben von der fixen Idee: Macht man nur das Geringste falsch, droht der quotenmässige Absturz. Es gibt nichts Innovationshemmenderes, ja nichts Innovationsfeindlicheres als diese Angst.[xvi] Dies lässt sich auf alle traditionellen Medien anwenden. Die Folge:
Anstelle von Kreativität und Innovation, von frischem Wind für das Publikum belässt man es dauernd beim bisher Bewährten und ändert beinahe nichts oder gar nichts oder aber, man produziert «Neues» nach immer denselben Strickmustern oder kopiert das, was sich irgendwo auf der Welt bereits bewährt hat. Die Programme – seien es diejenigen der PM, seien es die des ÖRR – gleichen sich international, ja global immer mehr an. Standardisierung und „More of the same“ – immer derselbe alte, abgestandene Wein in neuen Schläuchen – ist ein weiterer wichtiger Grund für den Rückzug des Publikums. Es langweilt sich immer mehr und wird auch deshalb immer zynischer den Medien gegenüber.
Quoten- und Profitmaximierung provozieren ein Race to the bottom
Die neoliberal orientierte Medienwirtschaft hat in den PM wie bei den ÖRR dieselben Auswirkungen:
– Entlassung von Journalistinnen und Journalisten: Ihr work load steigt drastisch, Zeit für Recherchen jenseits des von Google und KI Vorgekauten und Aufgewärmten gibt es immer weniger; Journalistinnen und Journalisten sind Träger von Know how, das mit ihnen verschwindet, wenn sie gehen müssen – die Fachkenntnisse in den Redaktionen werden dünner und dünner, oberflächliches Allgemeinwissen gewinnt wieder die Oberhand. Schon dies führt dazu, dass man in viel zu vielen Leitmedien praktisch dasselbe vernimmt.
– Im Streben nach der kurzfristigen Profitmaximierung haben die Medien ihre Korrespondentennetze dramatisch ausgedünnt – wo einst dank eigenen Korrespondentinnen und Korrespondenten Lebensnahes, Exklusives, Authentisches und Hintergründiges, Spannendes, Berührendes, manchmal auch Amüsantes aus allen Ecken der Welt zu erfahren war, müssen wir uns heute mit dem Einheitsbrei von sechs grossen Agenturen zufrieden geben. Auch dies ein Grund dafür, dass man in allen Leitmedien vielfach dasselbe vernimmt. Es kommt hinzu, dass diese Agenturen und Leit-Medien wie die New York Times und die Washington Post, die als Multiplikatoren dienen, alles andere als von Partikulärinteressen frei sind. Die Folgen:
Wo die Medienkonzentration immer mehr um sich greift und der Wettbewerb immer schwächer wird, wo das Know how der Medienschaffenden zunehmend sinkt, weil die Fachjournalisten den Generalisten weichen müssen, wo es eine fortschreitende profitsteigernde inhaltlich-redaktionelle Ausdünnung gibt, befinden sich die Medien – PM und ÖRR – in einem „Race to the bottom“: Die Medienwelt entwickelt sich zu einem immer ausgebleichteren, immer lebloseren Korallenriff. Keine vor Vitalität, vor Vielfalt und Farbe strotzenden Ökosysteme und Biotope, kein pralles Leben mehr – der allmähliche Niedergang der Leitmedien wird selber zum Symbol ihrer Vergänglichkeit und beschleunigt damit diesen Niedergang nur noch mehr.
Der Hauptbefund aus den bisherigen Darlegungen: Der Motor der News-Deprivation sind die Medien
Nicht die Menschen deprivieren sich selber um die Mediennutzung im Allgemeinen und die News-Rezeption im Besonderen, sondern die Medien deprivieren die Menschen: Für zunehmende Kreise der Bevölkerung verliert das heutige Mediensystem offensichtlich an Relevanz, weil es aus den oben dargelegten Gründen nicht mehr deren Bedürfnissen gerecht wird, nicht mehr Antwort auf jene Herausforderungen gibt, mit welchen sich die Menschen im Verlaufe ihres Lebens konfrontiert sehen und wobei ihnen die Medien Dienste leisten könnten. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angelangt: Das Grundproblem liegt darin, dass die Medien die Menschen für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren, statt ihre Leistungen von den Bedürfnissen der Menschen her zu definieren. Dies passiert, wie bereits erwähnt, zum einen infolge der neoliberalen Ausrichtung der Unternehmensführungen, zum andern infolge der zynischen Menschenbilder der Programmschaffenden, sei es, dass sie das Publikum für unterbelichtet halten und es mittels Propaganda auf den «rechten Weg» führen wollen, sei es, dass man es auf ein Bündel von Emotionen reduziert, die es zwecks Profit- bzw. Quotensteigerung auszureizen gilt. Das News-Deprivations-Narrativ des fög sieht die traditionellen Medien als gefährdete Opfer – in Tat und Wahrheit sind sie die Täter, sprich: die Urheber der Malaise.
Ein Ausweg aus der Deprivations-Krise: Ecce homo! (Siehe da, ein Mensch!)
Dieses Mediensystem wird langsam austrocknen und absterben – wenn es nicht zumindest bei den ÖRR zu einem radikalen Umdenken kommt: Sie müssen die Rolle jener publizistischen Konkurrenz übernehmen, die heute versagt! Dies nicht im Sinne eines Verdrängungswettbewerbs, sondern im Sinne eines Komplementärwettbewerbs, der das „Race to the bottom“ im Bereiche der traditionellen Medien stoppt. Die ÖRR müssen (wieder) eine hohe qualitative Messlatte setzen, welche die PM in ihrer Jagd nach dem schnellen Geld nicht unterschreiten dürfen, wenn sie nicht vollends untergehen wollen. Einst rechtfertigte sich die Existenz der Service public-Medien mit einer technischen und infolgedessen programmlichen Unterversorgung bestimmter Regionen und Bevölkerungskreise. Diese Art des Marktversagens gibt es längst nicht mehr. Das heutige Marktversagen, welches einen medialen Service public für die Demokratie unverzichtbar macht, ist ein Versagen im Bereich der gesellschaftlichen Relevanz, der Vielfalt, Vielschichtigkeit, Verlässlichkeit und der Einordnungsleistungen.
Dies heisst nicht zuletzt, dass zumindest die ÖRR ihr Menschenbild radikal ändern müssen:
1. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht unterbelichtete Wesen, welche durch die Medienschaffenden in die «richtige» Richtung geschubst werden müssen, sondern mündige Wesen, welche auf ihrem Weg durchs Leben medial vermittelte, vielfältige und vielseitige Informationen benötigen, damit sie die für sie richtigen Entscheidungen fällen können. Dies schliesst nicht aus, dass die Medien auch Meinungsbildung betreiben dürfen, aber: News first! Dies nach den folgenden Massgaben:
– Wir sind offen nach allen Seiten!
– Audiatur et altera pars!
– Wir machen uns keine Sache zu eigen, auch keine (vermeintlich) gute!
Wenn dann die Medienschaffenden auf der Grundlage dieser Auslegeordnung auch noch Meinungsbildung anbieten, ist dies in Ordnung, d.h. ein Service, welchen das Publikum allenfalls gerne annimmt – immer auf der Grundlage der Unvoreingenommenheit und Sachlichkeit.
Die Konsequenz dieses Ansatzes: Die primäre Aufgabe des medialen Service public ist die Organisation und Sicherung des gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Dialogs im Land und nicht die Rolle eines Meinungsmediums unter andern. Dies ist die Grundlage der freien Meinungsbildung der Menschen in der Demokratie Schweiz.
2. Die Menschen sind für die ÖRR nicht primär Wesen auf der Suche nach Emotionen, nicht Konsumentinnen und Konsumenten von Medieninhalten, sondern mündige Wesen, d.h. (selbst-)verantwortliche Bürgerinnen und Bürger, welche ein sinnerfülltes Leben führen und ihren Platz im Leben finden wollen.
Konkret bedeutet dies: Die ÖRR müssen sich auf die Seite des Publikums stellen und die Welt wieder aus seiner Perspektive betrachten und zu verstehen versuchen. Dies verlangt allem voran einen permanenten vorurteilslosen Dialog der Programmschaffenden auf Augenhöhe mit den Menschen im Land. Die Programmschaffenden müssen weg vom Computer, weg aus ihren Zentralen und Studios hinaus mitten ins Leben, um die alltäglichen Herausforderungen, Hoffnungen, Freuden, Leiden, Sehnsüchte und Ängste der Menschen zu registrieren, nachzuvollziehen und zu reportieren, d.h. in die Öffentlichkeit zu tragen.[xvii]
Dabei gilt es zu beachten: Sich an dem zu orientieren, was die Menschen vordergründig wollen, ist trivial.[xviii] Die hohe Schule des Medienschaffens ist, nicht dort stehen zu bleiben, sondern zu ergründen, was die Menschen wirklich auf ihrem Lebensweg brauchen. Auf dieser Grundlage würde auch die mediale Öffentlichkeit und die damit verbundene Politik lebensnaher, lebendiger, farbiger, attraktiver – Stichwort: Partizipation – als heute. Es wäre Sauerstoff für den demokratischen Dialog und damit für unsere Demokratie. Diesbezüglich ist die heutige Auseinandersetzung um den ÖRR, die sich alleine um Franken und Rappen dreht, mit Sicherheit nicht zielführend – im Gegenteil.
Auf der Grundlage einer solchen Haltung bzw. eines solchen Selbstverständnisses wäre eine erneute kopernikanische Wende denkbar: Der Service public instrumentalisiert die Menschen nicht mehr für seine eigenen betrieblich-unternehmerischen Interessen und Selbstzwecke, steuert die Menschen nicht mehr nach seinen Bedürfnissen, sondern definiert sich von den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger auf ihrem Weg durchs Leben her. Der ÖRR als Dienerin des Publikums und nicht mehr das Publikum als Dienerin des ÖRR – nicht Service public ist gefragt, sondern Service au public!
Der Gedanke dahinter: Wenn dieser Ansatz Erfolg haben sollte – um die Jahrtausendwende ist er mit der Informations-«Offensive» bei Radio DRS nachweislich eingetreten – wäre dies auch für das eine oder andere PM Anlass, diesem Beispiel zu folgen. Es könnte der Fall eintreten, dass die Medienwelt wieder von der heutigen, für die Demokratie so gefährlichen neoliberalen kurzfristigen Profitmaximierung auf die Leistungsmaximierung umschwenkt und wieder zu Qualität, Vielfalt, Relevanz, Verlässlichkeit bzw. Vertrauen findet: mediale Bereicherung statt Deprivation.
Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Medien – insbesondere die ÖRR – ihr heutiges zynisches Menschenbild und ihr neoliberales Wirtschafts- und Unternehmensverständnis auf eine sinnzentrierte, menschen- und gesellschaftsdienliche Unternehmensphilosophie und -praxis umpolen. Dies ist die Antwort auf den die Menschen, die Gesellschaft, die Politik und die Demokratie ruinierenden Neoliberalismus[xix] der Initiantinnen und Initianten der Halbierungsinitiative. Anderseits muss deren Gegenseite einsehen, dass der ÖRR in seiner heutigen zwitterhaften – um nicht zu sagen: schizophrenen – Verfassung seinen integrativen Auftrag ebenfalls nicht mehr erfüllt und deshalb auch dann keine Zukunft haben wird, wenn die Halbierungsinitiative bachab geschickt werden sollte: Für den ÖRR in der heutigen Form wird die Luft immer dünner.
Der Schlüssel: Leistungsorientierung für Kunden und Gesellschaft ist für Unternehmen langfristig vorteilhafter als kurzfristige Profitmaximierung!
Was hat der Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus den Menschen und der Welt gebracht? War es einst üblich, dass Unternehmen nützliche Dinge wie Socken, Brote, Mobilität, Information, Wissen etc. produzierten, so war und ist es nun oberstes Gebot, „Geld zu machen.“ Mit seinem berühmten Aufsatz „A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits“, erschienen am 13. September 1970 im New York Times Magazine, liess Milton Friedman, 1976 mit dem „Nobelpreis für Wirtschaft” ausgezeichnet, das totale marktradikale Profitstreben endgültig von der Leine: Er erklärte das Profitstreben zur obersten Maxime des Unternehmertums: „(…) in a free society (…) there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception and fraud.“
2011 bilanzierten Mark Kramer und Michael E. Porter[xx], Letzterer ein weltbekannter Wirtschaftslehrer an der Business School der Harvard University und selbst ein, wenn auch selbstkritischer Neoliberaler, 40 Jahre Neoliberalismus folgendermassen: „(…) In recent years business increasingly has been viewed as a major cause of social, environmental, and economic problems. Companies are widely perceived to be prospering at the expense of the broader community. (…) The legitimacy of business has fallen to levels not seen in recent history. (…) A big part of the problem lies with companies themselves, which remain trapped in an outdated approach to value creation. (…) They continue to view value creation narrowly, optimizing short-term financial performance in a bubble while missing the most important customer needs and ignoring the broader influences that determine their longer-term success.“
(Zu Deutsch: In den letzten Jahren wurde die Wirtschaft zunehmend als eine der Hauptursachen für soziale, ökologische und wirtschaftliche Probleme angesehen. Es herrscht die weit verbreitete Meinung, dass Unternehmen auf Kosten der Allgemeinheit prosperieren. (…) Die Legitimität der Wirtschaft ist auf ein in der jüngeren Geschichte beispielloses Niveau gesunken. (…) Ein großer Teil des Problems liegt bei den Unternehmen selbst, die nach wie vor in einem veralteten Ansatz zur Wertschöpfung verhaftet sind. (…) Sie betrachten Wertschöpfung weiterhin sehr eng, optimieren ihre kurzfristige finanzielle Performance in einer Blase, während sie die wichtigsten Kundenbedürfnisse übersehen und die umfassenderen Einflüsse ignorieren, die ihren langfristigen Erfolg bestimmen.“ Red.)
Wie finden wir wieder aus der menschen-, gesellschafts- und demokratiefeindlichen Tretmühle des Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus heraus? Wie lässt sie sich aus dem nihilistischen Selbstzweck des Primats der Friedmanschen Profitmaximierung befreien und wieder in den Dienst an Menschen und Gesellschaft stellen, indem die Unternehmenswelt das produziert, was für diese von Nutzen ist? Dies erfordert, dass sich die Unternehmenswelt wieder von aussen, von den Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft her definiert und nicht von innen (von ihrem einzigen und eigennützigen Ziel der Profitmaximierung her) nach aussen. Aus dieser Perspektive ist das von Jim Clemmer [2017] so genannte „Profit-Paradox“ alles andere als paradox:
„Many studies have shown that profits follow from worthy and useful purposes. Fulfilling the purpose comes first; then the profits follow. Profits are a reward. The size of our reward depends on the value of the service we’ve given others.“
(Zu Deutsch: „Viele Studien haben gezeigt, dass Gewinne aus sinnvollen und nützlichen Zwecken resultieren. Zuerst kommt die Erfüllung des Zwecks, dann folgen die Gewinne. Gewinne sind eine Belohnung. Die Höhe unserer Belohnung hängt vom Wert der Dienstleistung ab, die wir anderen erwiesen haben.“ Red.)
Mit anderen Worten: Steuere die Ursachen des Erfolgs, nicht den Erfolg selber! Einst eine unternehmerische Selbstverständlichkeit – wir erinnern uns an Hugo Bütlers Statement, der wichtigste Zweck der NZZ sei nicht das Geldverdienen, sondern ein Beitrag an die demokratische Meinungsbildung, will heissen: Profit dank Leistung und nicht Profit um des Profites willen. Damals war die NZZ noch ein Weltblatt…
Wo mit der Transformation der ÖRR ansetzen? «Culture eats strategy before breakfast!” (Peter F. Drucker): Allem vorangehen muss ein Wandel der Philosophie und Kultur der ÖRR, der Rest (Strategie, Prozesse, Strukturen…) ergibt sich daraus von selbst. Allerdings benötigt die Entwicklung einer solchen Unternehmensphilosophie und -kultur die Partizipation der Mitarbeitenden. Schöne Deklarationen und Broschüren im Internet, formuliert von irgendwelchen Stabstellen, helfen da nicht weiter…
Die Info-Offensive von Radio DRS war wohl nicht zuletzt auch deshalb ein Erfolg, weil zugleich eine entsprechende partizipative Unternehmenskulturentwicklung erfolgte. Sie bündelte die Arbeit der Mitarbeitenden und ihr berufliches Selbstverständnis auf ein gemeinsames hochgestecktes Ziel hin und löste enorm viel Reflexion und Kreativität aus. Die Losung hiess: «SR DRS ist die kleine BBC der Schweiz!» – damals war die BBC noch der hellste Stern am öffentlich-rechtlichen Medienhimmel und ein publizistischer Ehrentitel – bis auch in der Medienwelt Grossbritanniens der Neoliberalismus zuschlug…
1989 ging die sozialistische Welt an der Unüberbrückbarkeit zwischen Theorie bzw. Ideologie und von den Menschen erfahrener Praxis unter – die Menschen liefen dieser Welt buchstäblich davon. Nicht zuletzt die Problematik der News-Deprivation zeigt, dass sich auch im Neoliberalismus der Graben zwischen Theorie / Ideologie und Praxis immer weiter öffnet – die Menschen laufen der traditionellen Medienwelt davon (und nicht nur in dieser). Letztlich ist die durch neoliberale Kreise lancierte Halbierungsinitiative nicht bloss ein Angriff auf die SRG, sondern auf die traditionelle Medienwelt insgesamt – ein von ihr mit verschuldeter.
Zum Autor: Heinrich Anker (*1952) absolvierte zunächst eine Redaktionslehre an einer mittelgrossen Tageszeitung, erwarb auf dem 2. Bildungsweg die eidg. Matur und studierte an der Uni Bern zunächst fünf Jahre Geschichte, Soziologie und Medienwissenschaften und schloss sein Studium vier Jahre später mit einem Lizentiat in Volkswirtschaftslehre ab. Von 1989 bis 1997 leitete er die Radiopublikumsforschung an der Generaldirektion SRG, wo er auch seine Doktorarbeit zum Thema „Wertwandel und Mediennutzung in der Schweiz. Die Radionutzung 1975 bis 1992 im Spiegel der Publikumsforschung der SRG (Verlag Sauerländer, Dokumentationen zur Kommunikations- und Medienpolitik, 1995)“ verfasste. Von 1997 bis 2008 wirkte er in der Direktion von SR DRS als Programmentwickler sowie im Bereich der Unternehmenskultur und -strategie. 2008 machte er sich als Berater auf dem Gebiet der Unternehmenskultur-Analyse und sinnzentrierten Unternehmenskulturentwicklung selbständig, verfasste zu diesem Thema mehrere Monographien und unterrichtete an verschiedenen Fachhochschulen zum Thema Medien, Wirtschaftsethik und sinnzentrierte Unternehmenskultur.
[i] Jahrbuch Qualität der Medien Hauptbefunde 2025, Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, Universität Zürich, S. 1.
[ii] Intern führte dies zu «animierten» Auseinandersetzungen. Die Leitung von DRS 3 pochte auf möglichst kurzen Info-Sendungen, um die sog. «Durchhörbarkeit» – den Programmfluss – nicht zu beeinträchtigen, die Leitung der Abt. Info wollte ihrem Ethos der Qualität und Verlässlichkeit gerecht werden. Der Entscheid zugunsten der Lang-Version der Abt. Information stellte sich als richtig heraus: Die Akzeptanz von Info 3 war sofort sehr gross und führte den vor allem von deutschen Radioberatern vertretenen Mythos der Durchhörbarkeit ad absurdum. Das Publikum verlangt nach dramaturgischer und inhaltlicher Abwechslung und Vielfalt. Dies zeigte sich auch im Musik-Bereich: Auf Verengungen des Musikrepertoires (zwecks angeblicher Wiedererkennbarkeit des Programms, so das Argument aus der Beraterszene) reagierte das Publikum von Radio DRS negativ, auf dessen Verbreiterung positiv. Der Grund: In Gruppendiskussionen zeigte sich das Publikum immer tolerant. Es besass nicht die ihm von vielen Radiomachenden unterstellte hedonistische Erwartung, dass jeder Titel gefallen muss, vielmehr zeigte sich immer wieder Toleranz: «Es gibt Menschen mit einem andern Musikgeschmack als meiner – diese sollen auch auf ihre Rechnung kommen! Wenn ich nur ab und zu – und nicht ständig – Titel höre, die mir gefallen, bin ich zufrieden!» Dies spricht für die Toleranz, Reife und Mündigkeit des Publikums, die bis dato von den Medienschaffenden – und offensichtlich auch im Schosse der Medienwissenschaften – unterschätzt wird. Die Rezipientinnen und Rezipienten sind nicht die hedonistisch-utilitaristischen, geistlosen, emotionssüchtigen Wesen, als welche sie viele Medienschaffende – und die Medienwissenschaften – betrachten und «behandeln».
[iii] Dies war eine starke Antwort von Radio DRS auf die mittägliche Info-Offensive von Seiten TV DRS bzw. heute SRF. Warnung war die Suisse romande. Sowohl in der deutschen wie der französischen Schweiz verzeichneten die Radioprogramme der SRG dank den Radionachrichten am Mittag die höchsten Nutzungsspitzen im Tagesablauf – eigentliche Matterhörner der Radionutzung. Mit der Einführung von Mittagsnachrichten im Fernsehen der Suisse romande fiel das Matterhorn von Radio Suisse romande in sich zusammen. Es verlor in der Folge erheblich an Reichweite.
[iv] Einen Misserfolg gab es jedoch auch zu verzeichnen: Radio DRS 4 Info kam nie richtig zum Fliegen – wer zu spät kommt, den bestraft das Leben: Fast parallel zum Start von Info 4 startete das Internet, dies mit der Folge, dass Informationen und News im Web zu jeder beliebigen Zeit abrufbar wurden – ein News-Programm on air mit einer starren Stundenuhr wurde obsolet. Andere Gründe für den Misserfog sind im Marketing der SRG zu suchen: Weder wurde SRF 4 Info von den eigenen Programmen von Radio DRS intensiv beworben, noch durch das Schwestermedium TV: Crosspromotion findet bei der SRG nur höchst sporadisch statt. Nicht zuletzt aus Angst, mit der Bewerbung anderer Sendungen und Programme das eigene Angebot zu schwächen. Dies führt zu Fragen des Selbstverständnisses der Mitarbeitenden in den Regionen, d.h. zur Frage, wie sehr sie sich dem Dach SRG verbunden und verpflichtet fühlen.
[v] Dafür stehen in der Schweiz insbesondere die NZZ-Gruppe, die Tamedia- und die Ringier-Medien, CH-Media sowie die SRG, in Deutschland ARD, ZDF, die grossen Medienhäuser wie Bertelsmann, Burda, die FAZ, die Süddeutsche etc., (welche auch die wichtigsten Privat-TV-Medien betreiben). Sie können auch als Leitmedien bezeichnet werden.
[vi] Ein Beispiel ist die NZZ: Der ehemalige NZZ-Chefredaktor Hugo Bütler konnte sich noch dahingehend äussern, der wichtigste Zweck der NZZ sei nicht das Geldverdienen, sondern ein Beitrag an die demokratische Meinungsbildung – Leistung hat Vorrang. Die mittlerweile verabreichte Kur der Kosten- und Leistungsreduktion im Zeichen der neoliberalen Eigennutzenmaximierung ist der NZZ in der langen Frist nicht gut bekommen: Sie stieg vom einstigen Weltblatt ab zu einem Medium, das höchstens noch in bestimmten Kreisen von Wirtschaft und Politik der Schweiz Bedeutung hat. Dasselbe gilt mutatis mutandis für den Tages-Anzeiger. Mit dem Gratisblatt 20 Minuten hat der Tagi die schweizerische Medienlandschaft nicht bereichert, sondern sie allmählich ausgehungert – und befindet sich nun selber im ökonomische und publizistischen Kriechgang: Konzentrationen, Entlassungen – ergo dünnere Suppe – noch und noch.
[vii] Explizit gemeint sind damit die ÖRR der Schweiz, Deutschlands, Österreichs und Grossbritanniens, mit denen der Schreibende professionelle Verbindungen pflegte.
[viii] Die Quote entfaltet schon seit den 1970er Jahren in den ÖRR eine subversive Wirkung. Das Beispiel SRG: Die Mediennutzungsforschung wurde schon in den 70er Jahren grösstenteils von der Werbemittelforschung und -vermarktung in die SRG als Programmproduzent transferiert. Die Werbemittelforschung ist auf die Fliegenbeinzählerei ausgerichtet: Sie will Werbekontakte verkaufen – es geht um Quantitäten, nicht Qualitäten. Dieses Quoten-Primat machte sich auch im Programmbereich breit: Grob geschätzt flossen bei der SRG in den 20 Jahren, in welchen der Schreibende mit der SRG-Publikumsforschung verbunden war, zwei Drittel des Forschungsetats in die streng quantitative Nutzungsforschung (Medienstudie, Telecontrol, Radiocontrol…) und ca. ein Drittel in eine eher quantitative Forschung. Allerdings ging es auch bei dieser fast ausschliesslich um Publikumspräferenzen, derweil der gesellschaftlich-integrative Auftrag der SRG bis dato nicht systematisch empirisch erfasst wird. Stellvertretend für diese Ambivalenz zwischen Qualität und Quote steht ex-SRG Generaldirektor Armin Walpen: «Wir wollen keinen Service public sans public.» Für sich spricht auch die Haltung des ehemaligen Radiodirektors Andreas Blum sel., der vom «Spagat zwischen Markt und Auftrag» sprach – eine verhängnisvolle Paralyse, die auf das zynische Lippmannsche Menschenbild zurückzuführen ist, welches auch im Service public herumgeistert: Die Menschen als unterhaltungssüchtige Hedonisten, welchen Information und Meinungsbildung gegen den Strich eingetrichtert werden muss. Dieses Menschenbild kommt demjenigen des utilitaristisch-hedonistischen homo oeconomicus der Neoliberalen sehr nahe. Schon diese Nähe ist für den Service public eine Hypothek. Es kommt hinzu, dass dieses Menschenbild in der Praxis versagt: Die Info-Deprivationskrise der Medien – der ÖRR und der PM – ist ein eindrückliches Beleg dafür: Die neoliberalen Medienwelt ruiniert sich, d.h. ihr Business, gefangen in ihrer Profitgier, zusehends selber.
[ix] Es gibt noch Redaktionen ausserhalb dieser Zentralen, aber sie haben an Bedeutung verloren.
[x] Dies nach der Vorgabe US-amerikanischer, konsequent profitorientierter Medien. Der publizistische und kulturelle Schaden wird ausserhalb von Fachkreisen kaum richtig eingeschätzt: In Medien, in welchen die Mitarbeitenden für alle Medientypen – Radio, TV, Internet – produzieren, gehen die dramaturgischen Spezifika der einzelnen Medien allmählich verloren und damit auch ihre Attraktivität für das Publikum.
[xi] Es entbehrt nicht der Ironie: Die ÖRR handeln mutatis mutandis nach denselben neoliberalen Unternehmens- und Wirtschaftsprinzipen wie ihre schärfsten Gegner. Ihnen ist nicht bewusst, dass dieses betriebswirtschaftliche Konzept der Effizienzsteigerung alles andere als ideologiefrei ist.
[xii] Zit. nach Gerhard, Volker, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2002, S. 223.
[xiii] …um dann für die selbstverschuldete Misere freundeidgenössisch Subventionen zu beziehen … Mit dem Zauberwort «Demokratie» lässt sich jeder Sesam öffnen.
[xiv] Das Bakom vergibt zwar Aufträge in dieser Richtung, aber diese sind partieller Natur und nicht kohärent auf die Auftragserfüllung der SRG fokussiert. Zudem werden sie teilweise von Instituten ausgeführt, die zumindest zur Zeit des Schreibenden auch von der SRG selber Aufträge erhielten. Entsprechende Reporting-Konzepte wurden bei Radio DRS einst eingeführt, die Leitung der SRG verzichtete jedoch darauf, sie unternehmensweit – für die gesamte SRG – einzuführen. Es gibt auf der Stufe der einzelnen Unternehmenseinheiten entsprechende Konzepte, aber eine SRG-weite unité de doctrine gibt es nicht. Dahinter steht auch die Frage, ob die Unternehmenseinheiten oder die Generaldirektion die SRG steuert. Damit stossen wir auf organisatorisch-institutionelle Fragen, die hier nicht aufgegriffen werden können, die jedoch für den heutigen, nicht mehr über jeden Zweifel erhobenen Status der SRG und ihrer Leistungen mitverantwortlich sind. In Deutschland gibt es in den Medienwissenschaften und in den ÖRR selber entsprechende Bemühungen – der Schreibende war in entsprechende Bemühungen involviert -, aber ein allgemein anerkanntes System zum Controlling des Programmauftrags der ÖRR hat sich bislang nicht durchgesetzt und etabliert.
[xv] Covid: Siehe RKI-Skandal in Deutschland, in der Schweiz den direkten Draht zwischen Ringier und engsten Beratern des Bundesrates. Radio DRS verzichtete bewusst auf die Einladung von kritischen Stimmen wie z.B. Bhakti und Wodarg – das Publikum hatte und hat keine Chance, verschiedene Meinungen zu vernehmen und sich selber ein Urteil zu bilden. Ernüchternd auch der Umgang mit Informationen im russisch-ukrainischen Krieg. Im Falle der Publikation von Studien des German Marshall Fund wird auf Radio SRF nicht darauf hingewiesen, dass dieser eine Institution der Transatlantiker ist, welche eindeutig auf ukrainischer Seite stehen, und wenn am Radio jemand von der deutschen Stiftung «Wissenschaft und Politik» zur Sprache kommt, wird das Publikum nicht darüber informiert, dass diese Stiftung ein Think Tank der deutschen Bundesregierung ist (und wohl in der Medienöffentlichkeit nicht gegen deren Politik argumentiert). Vielmehr werden solche Mitarbeitenden von Think Tanks als Experten oder Wissenschafter deklariert – wobei man als Rezipient irrtümlich davon ausgeht, sie seien unabhängig und unparteiisch.
[xvi]Getoppt wird diese Innovationsbremse höchstens noch von Statements eines ehemaligen SRF-TV-Direktors, der behauptete: «Im TV gibt es nichts Neues mehr auf der Welt!».
[xvii] Dass die SRG nun im Vorlauf zur SVP-Halbierungsinitiative aus Werbezwecken TV-Prominenz an Stammtische schickt, kommt Jahre zu spät, und es ist fraglich, ob dies aus einer ehrlichen Haltung des Dienens und der Demut heraus kommt oder aus einer Haltung der Vertretung der Interessen der SRG als Medienbetrieb.
[xviii] Auf dieser Stufe operieren die heutige Marktforschung und Medien-«Communities» im Internet.
[xix] Mit seiner Philosophie des Aufbaus von Wirtschaft und Gesellschaft auf der Grundlage des Rechts des Stärkeren und des kompromisslosen «The winner takes it all!» widerspricht er dem Grundgedanken der liberalen Demokratie diametral.
[xx] Porter, Michael E., Mark R. Kramer [2011]: „Creating Shared Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth“, in: Harvard Business Review, January-February 2011.