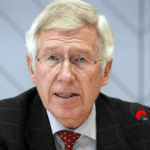EU-Verträge – «Die EU diktiert, die Schweiz übernimmt»
(Red.) Nein, diese Verträge mit der EU, die von einigen Parteien und Organisationen «Bilaterale III» genannt werden, können mit gutem Gewissen nur zur Ablehnung empfohlen werden. Es genügt zuzuschauen, wie Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, den Russenhass einsetzt, um wenigstens in einem Punkt eine gemeinsame Position der EU zu erreichen – und auch dies ohne Erfolg. Aber auch wenn man genau hinschaut und sieht, in welchen Punkten sich die Schweiz der EU beziehungsweise ihrer Führung einfach ausliefern müsste, kann man nur zu einem Nein kommen. Ein Interview mit der Rechtsanwältin Andrea Staubli, erschienen in der Publikation «Zeitgeschehen im Fokus», zeigt etliche Details. (cm)
Zeitgeschehen im Fokus: Der Bundesrat bezeichnet in Anlehnung an die bilateralen Verträge I und II die jetzt anstehenden EU-Verträge auch als Bilaterale. Er hat immer wieder gesagt, dass die neuen EU-Verträge den bilateralen Weg absichern und weiterentwickeln würden. Ist diese Argumentation zutreffend?
Andrea Staubli: Der Bundesrat spricht davon, dass diese Verträge «den bilateralen Weg mit der EU stabilisieren und weiterentwickeln» sollen. Wenn man schaut, was die neuen Verträge alles beinhalten, stellt man fest, dass es eine völlige Verharmlosung ist, wenn der Bundesrat von den bilateralen Verträgen III spricht. Man kann die bilateralen Abkommen nicht mit den aktuellen EU-Verträgen vergleichen, weil die institutionelle Anbindung darin ein wesentlicher Bestandteil ist. Bei bilateralen Verträgen, die zwischen zwei Vertragspartnern abgeschlossen werden, hat jeder Vertragspartner Rechte und Pflichten, die für beide im Vertrag festgelegt sind. Der institutionelle Teil der EU-Verträge geht weit über das hinaus. Hier vom bilateralen Weg zu sprechen, ist Sand in die Augen der Bevölkerung gestreut. Der Bundesrat erhofft sich so weniger Widerstand.
ZiF: Wenn bei bilateralen Verträgen beide Vertragspartner gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben, wären sie gleichwertige Partner. Wie ist das bei den EU-Verträgen?
Andrea Staubli: Im Grundsatz ist das zutreffend. In den nun vorliegenden Abkommen findet man allerdings keine Gleichwertigkeit. Die EU diktiert, die Schweiz übernimmt. Betrachten wir zum Beispiel die «dynamische Rechtsübernahme». Der Begriff «dynamisch» ist irreführend. Es gibt keine Dynamik. Fakt ist, dass es dabei mit wenigen, vernachlässigbaren Ausnahmen faktisch um eine automatische Übernahme von EU-Recht geht. Die Schweiz muss also telquel übernehmen.
ZiF: Sind das Veränderungen, die erst nach Abschluss der Verträge entstehen?
Andrea Staubli: Die «dynamische» Rechtsübernahme betrifft zukünftige Gesetzesänderungen in der EU. Dabei wird zwischen einer Integrationsmethode und einer Äquivalenzmethode unterschieden. Egal, welche Methode zur Anwendung gelangt, ist die Schweiz am Ende dazu verpflichtet, das EU-Recht inhaltlich umzusetzen. Gemäss dem Erläuternden Bericht des EDA muss damit «das gleiche Ergebnis erzielt werden, das mit den betreffenden EU-Rechtsakten angestrebt wird».
Wir müssen uns allerdings bewusst sein, dass in den nun zur Diskussion stehenden Verträgen EU-Recht der letzten Jahrzehnte einfliesst. Das sehen wir an den rund 20 000 Seiten EU-Ausführungsverordnungen. Diese müsste die Schweiz übernehmen. Das – kombiniert mit der dynamischen Rechtsübernahme – würde enorme Auswirkungen auf die Gesetzgebung der Schweiz haben. Unser bisheriges Rechtsverständnis würde auf den Kopf gestellt, schweizerische Eigenheiten gingen verloren.
In diesem Kontext ist auch die Auslegung der Abkommen zu diskutieren. Es wird festgehalten, dass die Abkommen einheitlich ausgelegt werden sollen. Doch, wer soll diese Aufgabe übernehmen?
ZiF: Was geschieht, wenn man sich in der Auslegung der Gesetze nicht einig wird?
Andrea Staubli: Bestehen unterschiedliche Ansichten zwischen der Schweiz und der EU, wie eine Bestimmung in diesen Vertragswerken zu verstehen respektive auszulegen ist, wird eine solche Frage letztendlich vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschieden. Der EuGH wird sich dabei am europäischen Recht orientieren – kaum an der Schweizer Rechtstradition.
Sollte es also zu Differenzen zwischen der Schweiz und der EU kommen, wird das institutionelle Streitbeilegungsverfahren angewendet. Der Ablauf ist in den meisten Abkommen umschrieben. Dazu bestimmt jede Seite die gleiche Anzahl Schiedsrichter. Diese bestimmen dann eine weitere Person, die den Vorsitz übernimmt. Das Schiedsgericht kann eine Entscheidung fällen und/oder es kann den EuGH um eine Auslegung anfragen. Die Entscheidung des EuGH ist dann für alle Seiten rechtsverbindlich.
Wir können also festhalten: Sowohl Fragen der Auslegung als auch das Streitbeilegungsverfahren sind mächtige institutionelle Elemente, die im Sinne der EU zur Anwendung gelangen werden. Die Auswirkungen auf das Schweizer Rechtswesen werden gravierend sein.
ZiF: Das politische System der Schweiz funktioniert ganz anders als das System der EU. Die «dynamische» oder ehrlicher gesagt «automatische» Rechtsübernahme steht dem System der direkten Demokratie diametral entgegen. Wenn die Schweiz neue Gesetze übernehmen müsste, besteht immer die Möglichkeit, dass das Volk darüber abstimmen kann, wenn das Referendum ergriffen wird. Bei einer Verfassungsänderung braucht es zwingend eine Volksabstimmung. Dann könnte es sein, dass das Schweizer Volk «Nein» sagt. Und Nein heisst «Nein». Was wird das für Folgen haben?
Andrea Staubli: Gemäss Artikel 140 Bundesverfassung (BV) müssen Änderungen der Bundesverfassung Volk und Ständen (also den Kantonen) unterbreitet werden (sogenanntes obligatorisches Referendum). Das gilt nach ungeschriebenem Verfassungsrecht auch für völkerrechtliche Verträge, die aufgrund ihrer Bedeutung auf der Stufe der Bundesverfassung stehen. 50 000 Stimmberechtigte können verlangen, dass ein Bundesgesetz dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wird (sogenanntes fakultatives Referendum). Diese Mitsprachemöglichkeiten sind essentielle Grundpfeiler der direkten Demokratie in der Schweiz.
Laut Bundesrat werde die direkte Demokratie durch die EU-Verträge nicht eingeschränkt, also weder das Referendums- noch das Initiativrecht. Die EU müsse das akzeptieren. Wenn man allerdings genauer hinschaut, sieht es ganz anders aus. Formell haben wir natürlich diese Rechtsinstrumente. Aber: Wird ein EU-Gesetz in einer Volksabstimmung abgelehnt, kann die EU sogenannte Ausgleichsmassnahmen gegenüber der Schweiz ergreifen. Die EU interessiert nicht, was das Schweizer Volk entscheidet. Wenn die Schweiz die EU-Vorgaben aufgrund einer Abstimmung nicht umsetzen würde, hätte die Schweiz einen Vorteil gegenüber der EU, so die Argumentation, und deswegen müsste die Schweiz einen Ausgleich leisten.
Das kann ein finanzieller Ausgleich sein in Form einer Strafzahlung (die man natürlich offiziell nicht so benennt) oder dass man der Schweiz den Zugang zu einem Gremium oder einer Institution, der ihr aufgrund der Verträge zustünde, verweigert. Es liegt folglich ein nicht zu unterschätzender Druck auf dem Bundesrat. Die Schweiz wäre nicht mehr frei in ihrer Entscheidung.
Wenn wir uns anschauen, welche Themenbereiche in diesen Verträgen geregelt werden, betrifft das alle Bereiche des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens: Strassen- und Luftverkehr, Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit, Gesundheit, Strom und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Rahmen einer Abstimmung zu einem ablehnenden Entscheid kommt, ist also durchaus gegeben. Wenn wir hier weiterdenken, können wir uns ausmalen, wie «objektiv» die Erläuterungen des Bundesrats im Abstimmungsbüchlein ausfallen würden.
ZiF: Inwieweit ist der Bundesrat überhaupt gewillt, demokratische Entscheide zuzulassen?
Andrea Staubli: Die Frage stellt sich. Er hat im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zu den Verträgen gesagt: «Der Bundesrat hat entschieden, das Vertragspaket dem fakultativen Referendum zu unterstellen.» Der weitreichende Eingriff in unser Rechtssystem verlangt aber, dass man die Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt. Das bedeutet, dass Volk und Stände beziehungsweise die Kantone diese Verträge gutheissen müssten, damit sie überhaupt zur Anwendung kommen. Weil der Bundesrat genau weiss, dass das Ständemehr eine Annahme in Frage stellt, will er von Anfang an diese Gefahr ausschalten. Die Argumentation des Bundesrats ist unter anderem, da es sich nur um einzelne Vertragspakete handle, sei auch kein obligatorisches Referendum nötig. Man kann sich fragen, ob dies ein cleverer Schachzug des Bundesrats oder reine Augenwischerei ist, wie wir es mit dem Begriff der Bilateralen III gesehen haben. Damit täuscht der Bundesrat die Bevölkerung, indem er vorgibt, dass die Verträge nicht so weitreichend seien und daher ein fakultatives Referendum genüge.
ZiF: Warum hat der Bundesrat das institutionelle Abkommen mit der EU (InstA) damals zurückgezogen?
Andrea Staubli: Der Bundesrat hat 2021 entschieden, den institutionellen Weg nicht weiterzuverfolgen, sondern ein ganzes Paket an Abkommen und Vereinbarungen anzusteuern (Bilaterale III). In einem Faktenblatt vom 15. Dezember 2023 hat er festgehalten: «Unterschied zum institutionellen Abkommen: Im Gegensatz zum institutionellen Abkommen regelt der Paketansatz die institutionellen Fragen nicht in einem einzelnen Abkommen, sondern mit institutionellen Elementen in jedem einzelnen Binnenmarktabkommen.» Daraus kann man entnehmen, dass die institutionelle Anbindung genau gleich vorliegt wie beim fallengelassenen institutionellen Abkommen. Damals war unbestritten, dass es zu einem obligatorischen Referendum kommen muss. In dem heutigen Vertragspaket sind die wesentlichen institutionellen Aspekte in den einzelnen Abkommen analog vorhanden.
ZiF: Wie sähen die finanziellen Folgen aus?
Andrea Staubli: Der Bundesrat hält fest, dass das Paket sieben wichtige Punkte umfasst. Wir haben neue Abkommen über Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Dazu kommen die Beteiligung an Forschungs- und Kulturprojekten, der Bereich der Personenfreizügigkeit, die institutionellen Fragen, und die Vorschriften über staatliche Beihilfen. Die finanziellen Auswirkungen werden beträchtlich sein. Der Bundesrat gibt selbst zu, dass er noch gar nicht weiss, was finanziell alles auf die Schweiz zukäme. Was wir aber wissen: Die Schweiz zahlt und kann nur beschränkt mitbestimmen, wohin das Geld fliesst. Beispielhaft sei erwähnt: Einer der sieben Punkte ist der sogenannte «Verstetigte Schweizer Beitrag» (vormals Kohäsionsbeitrag). Unter diesem Titel zahlt die Schweiz in den Jahren 2030 bis 2035 350 Millionen pro Jahr. Allein das EU-Gesundheitsabkommen soll rund 50 Millionen pro Jahr verschlingen. Von den restlichen Abkommen haben wir jetzt gar noch nicht gesprochen.
ZiF: Welche Folgen hätte die Annahme der Verträge auf Gesetzesebene?
Andrea Staubli: Wegen der EU-Verträge müsste man in der Schweiz drei neue Gesetze ausarbeiten: das Beihilfeüberwachungsgesetz, das Bundesgesetz über die Verwaltungszusammenarbeit und das Kohäsionsbeitragsgesetz. Weiter müssten 35 Gesetze angeglichen werden, zum Teil mit substanziellen Anpassungen, vor allem im Ausländerrecht. Die Schweiz müsste vier verschiedene Verpflichtungskredite sprechen, und es braucht einen Bundesbeschluss zur «Etablierung einer parlamentarischen Zusammenarbeit». Wir können das Ausmass nur erahnen.
ZiF: Nach dem Überblick über die EU-Verträge nehmen wir noch das im EU-Paket enthaltene Gesundheitsabkommen unter die Lupe. Von der WHO sind Bestrebungen im Gange, die Gesundheitspolitik der einzelnen Staaten von oben zu bestimmen. Jetzt kann man sich schon ausmalen, was mit diesem Abkommen auf uns zukommt. Interessanterweise ist das bis heute kaum in der öffentlichen Diskussion, und daher gibt es wenige kritische Stimmen oder man lässt sie nicht in die Medien. Was bedeutet dieses Abkommen ganz konkret für die Schweiz?
Andrea Staubli: Das Gesundheitsabkommen mit dem vollständigen Namen «Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union über die Gesundheit» ist ein neues Abkommen und umfasst 81 Seiten. Ein Ziel ist, dass die Schweiz an den verschiedenen Gefässen beziehungsweise Institutionen der EU-Gesundheitspolitik partizipieren kann. Die Schweiz würde am ECDC (Europeen Center for Disease Prevention and Control) teilnehmen, sich am EWRS (Early Warning and Response System) beteiligen und Daten und Informationen aus diesem Frühwarnsystem erhalten. Sie könnte an einer Krisenkoordination teilnehmen und auch an den Programmen EU4Health. Prima vista klingt das ja ganz gut. Ein Virus macht nicht vor der Grenze halt, und so könnten wir in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die Herausforderungen gemeinsam anpacken. So wie die Verträge allerdings ausgestaltet sind, heisst es für die Schweiz, dass sie in erster Linie sensible Gesundheits- und Personendaten liefern und die EU-Vorgaben übernehmen muss. Es würde zum Beispiel nicht mehr unser eigener Pandemieplan gelten, sondern wir müssten den der EU mit seinen Vorschriften umsetzen. Die Umsetzung von EU-Recht hätte einen gravierenden Autonomieverlust für die Schweizer Gesundheitspolitik zur Folge. Die Schweiz würde zwar in den obgenannten Gremien sitzen, hätte allerdings kein Stimmrecht. Und sie müsste Geldbeiträge leisten, die einseitig von der EU festgelegt würden. Damit würde die Kompetenz des schweizerischen Parlaments, die Finanzen des Bundes zu kontrollieren, massiv eingeschränkt. Alles in allem könnte man sagen: «Viele Pflichten, aber kaum Rechte.»
ZiF: Hätten wir so eine Situation wie mit Covid, dann gäbe also die EU vor, was wir im Land zu tun und zu lassen hätten?
Andrea Staubli: Sollte das Gesundheitsabkommen angenommen werden, dann gälten für die Schweiz im Falle einer Pandemie die Vorgaben der EU, das ist so. Wenn wir von der Coronazeit ausgehen oder davon, dass ein neues Virus sich verbreitet, sagt die EU, was gilt, zum Beispiel Maskenpflicht oder ein vierwöchiger Lockdown. Auch wenn die Schweiz der Meinung ist, zwei Wochen würden auf alle Fälle genügen, müsste sie sich den Vorgaben der EU beugen. Sollte sie es nicht tun, würde der Streitschlichtungsmechanismus in Kraft treten, an dessen Ende der EuGH steht und eine Vertragsverletzung feststellen würde. Hier haben wir das Problem der fremden Richter, die die Entscheidung für die Schweiz träfen und sagten, was gelten sollte.
Zusammengefasst kann man sagen, wenn wir das EU-Recht übernehmen, verlieren wir an Autonomie und Souveränität, wenn wir es nicht übernehmen, verlieren wir den Zugang zu Informationen und Daten und müssen mit Strafzahlungen rechnen.
ZiF: Ein weiterer Aspekt dieses Gesundheitsabkommens ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es gibt in der EU den Digital Services Act (DSA), der die Aufgabe hat, Informationen im Netz zu zensieren. Welche Bedeutung hat er für die Schweiz?
Andrea Staubli: Das ist ein wichtiger Punkt. Mit der automatischen Rechtsübernahme ist die Schweiz verpflichtet, den DSA, also die entsprechenden Regeln, zu übernehmen. Die Bundesverfassung garantiert aber ganz klar die Meinungs- und die Medienfreiheit, die durch den DSA eingeschränkt würden. Die EU möchte diese Situation mit einer Chat-Kontrolle sogar noch weiter ausbauen. Das kann dazu führen, dass kritische Stimmen zu den Pandemiemassnahmen oder zu den mRNA-Injektionen auch in der Schweiz als Desinformation beurteilt und verboten oder auch bestraft werden müssten. Plattformen wären verpflichtet, ihre Inhalte zu sperren, wenn sie gegen den DSA verstossen würden. Die Schweiz hätte keine eigenständige Regelungskompetenz mehr. Damit würden die durch die Verfassung garantierten Grundrechte verletzt.
ZiF: Gibt es solch eine Regelung nicht auch in den von der WHO erlassenen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV)?
Andrea Staubli: Ja, die IGV von 2024, die am 19. September 2025 für die meisten Länder – auch für die Schweiz – in Kraft getreten sind, enthalten Zensurbestimmungen. Als der Bundesrat im Mai 2025 mitteilte, dass er die IGV gutheisse und annehmen werde, hat er jedoch bezüglich der Zensurbestimmungen einen Vorbehalt angebracht. Das heisst: Aufgrund dieses Vorbehaltes gelten die Zensurbestimmungen der IGV heute in der Schweiz nicht. Mit der Annahme des EU-Gesundheitsabkommens wäre dieser Vorbehalt obsolet. Interessant dabei ist der zeitliche Ablauf. Im Mai 2025 machte die Schweiz den Vorbehalt zu den IGV. Im Dezember 2024 hatte der Bundesrat bekannt gegeben, dass die EU-Verträge zum Abschluss gebracht worden seien. Zu dem Zeitpunkt hat er genau gewusst, dass der DSA umgesetzt werden müsste, wenn die Verträge angenommen würden. War der Vorbehalt eher ein Feigenblatt, damit er die kritischen Stimmen beruhigen konnte, oder hat der Bundesrat das tatsächlich nicht gemerkt?
ZiF: Denken wir zurück an die Corona-Zeit. Untersuchungen von namhaften Wissenschaftlern in der Schweiz, ich denke zum Beispiel an Konstantin Beck, an Pietro Vernazza oder an Ihre Organisation, das Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF Schweiz), könnten nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Andrea Staubli: Für unser freiheitliches Verständnis ist es nicht nachvollziehbar, dass so etwas wie ein DSA mit so massiven Auswirkungen ohne Not in der Schweiz übernommen wird. Wir sehen die Konsequenzen jetzt in Deutschland mit den Strafverfahren, die gestützt auf den DSA erfolgen. Die Schweiz wäre dann verpflichtet, das auch so zu machen. Das hätte unglaubliche Auswirkungen auf die Meinungs-, Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit. Was darf man dann noch sagen? Das wäre ein Rückschritt und ein riesiger Schaden für den wissenschaftlichen, aber auch für den demokratischen Diskurs.
ZiF: Ist das alles ein Zufall?
Andrea Staubli: Ich glaube nicht. Wir können ein interessantes Zusammenspiel verschiedener Ebenen beobachten. Mit den IGV haben wir die internationale Ebene. Die WHO hat den Begriff der Infodemie kreiert und ein Kontrollsystem mit Infodemie-Managern aufgezogen, die aktiv werden, wenn abweichende Meinungen zu den Vorgaben der WHO entstehen. Das ist nichts anderes als Zensur. Auf der Ebene EU haben wir die Vorschriften des DSA und auf nationaler Ebene muss die Schweiz sie umsetzen. Wir sehen bei den IGV, dass es ganz stark um Überwachung geht. Es geht um Sammeln von Daten und die Möglichkeit, Massnahmen, die wir alle aus der Coronazeit kennen, anordnen zu können. Es ist sicher kein Zufall, dass wir die Teilrevision des Epidemiengesetzes auf der Agenda haben. Der Bundesrat hat immer wieder gesagt, die IGV finden ihren Niederschlag im Epidemiengesetz. Hier wird ganz deutlich, wie der Mechanismus funktioniert, wie die Bestimmungen von der internationalen Ebene auf die nationale Ebene heruntergebrochen werden. Nimmt man dann noch das Gesundheitsabkommen mit der EU dazu, dann zeigt sich, dass das Ganze System hat. Das ist kein Zufall, sondern ein abgestimmtes ineinandergreifendes Ganzes.
ZiF: Was kommt hier auf uns zu?
Andrea Staubli: Wir müssen klar feststellen, dass die Schweiz ihre gesundheitspolitische Selbstbestimmung aufgeben würde. In unserem föderalen System ist Gesundheitspolitik eigentlich Sache der Kantone, die allerdings schon lange nichts mehr dazu zu sagen haben. Die Schweiz müsste nur noch übernehmen und könnte nicht mehr auf schweizerische, zum Beispiel auch regionale, Eigenheiten Rücksicht nehmen. Was im EU-Raum gilt, gilt dann auch für die Schweiz.
ZiF: Frau Staubli, vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Thomas Kaiser. Zum Original-Interview auf «Zeitgeschehen im Fokus».
(Red.) Die Redaktion von «Die Schweiz – online» hat am Ende des Interviews ein paar Zeilen mit einem Aufruf zur Unterzeichnung eines Vernehmlassungsverfahrens weggelassen, weil dort die Frist 31. Oktober bereits abgelaufen ist. Wir bitten um Verständnis. Aber wir werden diesem Thema weitere Beiträge widmen! (cm)